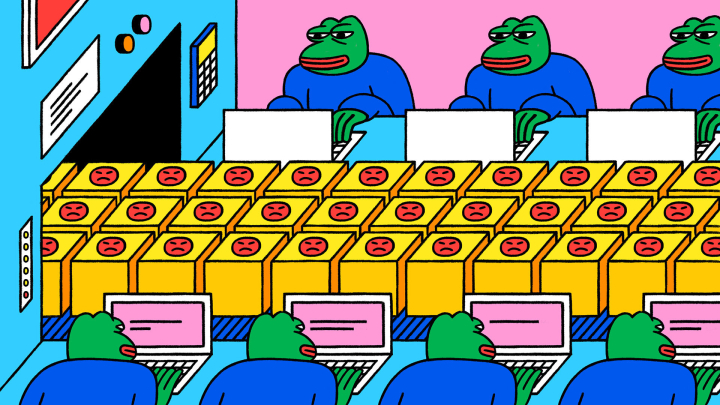„Wir hassen, und wir haben das Recht dazu“
In ihrem neuen Buch macht sich Şeyda Kurt auf die Suche nach dem widerständigen Potenzial eines Gefühls, das auf den ersten Blick niemand so recht haben will

Şeyda Kurt, Jahrgang 1992, ist Journalistin, Autorin und Moderatorin. 2021 veröffentlichte sie das Buch „Radikale Zärtlichkeit“. Darin untersuchte Kurt das Konzept der romantischen Liebe auf seine patriarchalen, kolonial-rassistischen, kapitalistischen Aspekte. Statt asymmetrischer Liebe forderte sie eine „radikal zärtliche Gesellschaft“, in der die Ressourcen so verteilt sind, dass sich alle Menschen gleichermaßen auf Augenhöhe begegnen können. Nun ist Kurts zweites Sachbuch erschienen: „Hass. Von der Macht eines widerständigen Gefühls“ (Harper Collins Verlag).
fluter.de: Şeyda Kurt, erst ein Buch über die Liebe, nun eins über den Hass. Warum ist es Ihnen ein Anliegen, über Gefühle zu sprechen?
Şeyda Kurt: Weil wir als Gesellschaft eine große Armut beim Sprechen über Gefühle haben. Nehmen wir das Beispiel der Eifersucht: Die Eifersucht einer Frau, die aus ökonomischen Gründen von ihrem Mann abhängig ist, ist etwas ganz anderes als die männliche Herrschaft über den weiblichen Körper, bei der es letztlich um Kontrolle und Besitzansprüche geht. Das sind unterschiedliche Phänomene. Die beteiligten Menschen handeln aus unterschiedlichen Gründen. Trotzdem nennen wir beides Eifersucht.
Woran liegt das?
Ich glaube, es gibt ein Bedürfnis nach einfachen Erzählungen und Kategorien. Auch werden Gefühle oft als etwas Natürliches wahrgenommen. Blickt man aus einer politischen Perspektive auf sie, merkt man schnell, dass Gefühle wie Liebe oder auch Hass unmittelbar mit Herrschafts- und Machtverhältnissen, mit Klassenkampf und mit antikolonialen Kämpfen zusammenhängen. Genau deshalb eröffnen Gefühle meiner Meinung nach ein großes Spektrum an Widerstandsformen. Gefühle mobilisieren, weil sie die Menschen abholen in ihrem Unbehagen, ebenso wie in ihrem Begehren.
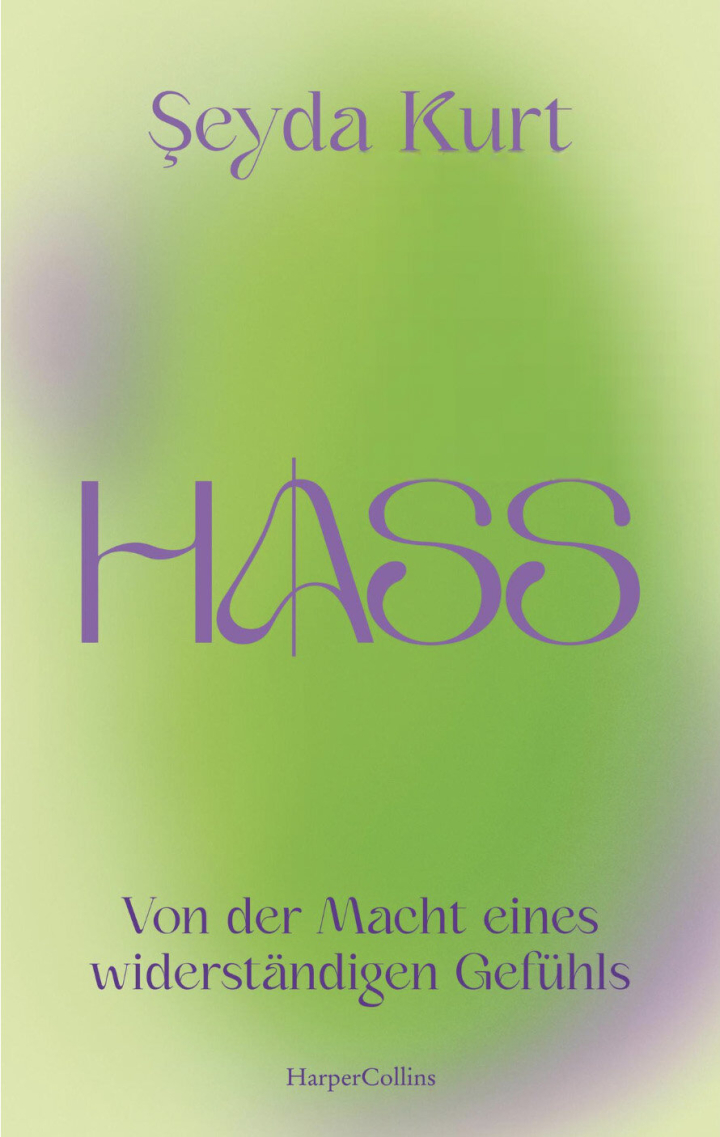
Wie weit war der Weg von der Zärtlichkeit zum Hass?
Die beiden Gefühle passen sehr gut zusammen. Nicht wie Yin und Yang. Sondern weil die Liebe zur Gerechtigkeit, um die es mir im ersten Buch geht, einen gewissen Hass auf die Ungerechtigkeit mit sich bringt.
Bei diesem Thema denken viele an den Hass von rechts oder an Hass im Netz, der kommt in Ihrem Buch aber nur als Kulisse vor. Welchen Hass gucken Sie sich an?
Ich schaue mir bewusst die Perspektive marginalisierter Menschen an und frage: Bringt sie der Hass einer radikal zärtlichen Gesellschaft näher, oder isoliert und zerstört er sie? Ich glaube, Hass kann der Gleichgültigkeit entgegenwirken. Denn er braucht eine Fixierung auf ein Objekt. Die Philosophin Hilge Landweer sagt, Hass sei anders als Verachtung. Die Verachtung wendet sich vom Gegenüber ab. Sie entmenschlicht. Der Hass nimmt sein Gegenüber ernst. Es geht darum, sich nicht abzuwenden, weil man denkt: Es ändert sich ja eh nichts. Es muss darum gehen, die Unterdrückungsverhältnisse der Gesellschaft ernst zu nehmen und sich zu fragen, wie man daraus ausbrechen kann.
Es geht Ihnen also um Widerstand?
Um Widerstand und Selbstverteidigung. Für meine Recherche habe ich auch das Buch „Selbstverteidigung“ der französischen Philosophin Elsa Dorlin gelesen. Darin geht es um antikoloniale, aber auch um feministische Praktiken der Selbstverteidigung. Dorlin fragt sich: Wie wurde historisch Widerstand geleistet? Muss dieser Widerstand explosionsartig daherkommen und alles niederreißen? Oder geht es eher darum, immer wieder Grenzen zu überschreiten, um den Widerstand so im Alltag zu etablieren? Diese Fragen habe ich mir auch gestellt. Die Wut feiert aktuell eine Art feministisches Comeback. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich mit meiner Wut eine gewisse Schwelle nicht überschreiten darf.
Inwiefern?
Es gab in letzter Zeit einige Veröffentlichungen, die sich mit weiblicher Wut befassen; damit, dass Wut ein männliches Privileg ist, das Frauen nicht zugestanden wird. Mein Eindruck ist, dass solche Debatten im liberalen Mainstream als augenzwinkernder Lifestyle daherkommen müssen und dass weibliche Wut bloß nicht zu unbequem werden darf. Ich wollte ein Buch schreiben, das dezidiert unbequem ist. Das Hässlichkeit wagt und grollt. Hinzu kommt, dass ich in den letzten Jahren als Journalistin viel zu dem rassistischen Terroranschlag in Hanau gearbeitet habe.
Sie haben zum Beispiel an dem Podcast „190220 – Ein Jahr nach Hanau“ mitgewirkt.
Dabei habe ich festgestellt, dass Menschen, die von den Anschlägen betroffen sind, also die Angehörigen der Getöteten von Hanau, ausschließlich als Objekte des Hasses behandelt werden. Sobald sie ihren Zorn zeigen oder sagen „Ohne Gerechtigkeit gibt es für uns keinen Frieden“, werden sie delegitimiert. Von Opfern wird erwartet, dass sie vergeben. Mich interessiert, wie Menschen, die von Rassismus betroffen sind, oder Menschen in Klassenkämpfen, in antikolonialen Kämpfen immer wieder abgesprochen wird, dass auch sie hassend sein können. Dieses Tabu will ich offenlegen.
Also geht es Ihnen um Agency, sprich die Fähigkeit zum absichtsvollen und zielorientierten Handeln?
Spricht man einer Person ab, hassend sein zu können, geht das immer mit dem Verlust von Handlungsfähigkeit einher. Dasselbe gilt aber auch für die Zuschreibung von Hass von außen. Im kolonialen Zeitalter wurde er immer wieder als vermeintliche Eigenschaft von kolonisierten, rassifizierten, versklavten Menschen heraufbeschworen, um sie in der Folge zu entmenschlichen. Um zu sagen: Der kolonisierte Mensch ist nicht mehr als ein hasserfülltes Objekt. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel schreibt im 19. Jahrhundert von Völkergeistern, „die in ihrem Hasse sich auf den Tod bekämpfen“. Das bedeutet: Sie sind nicht zur Zivilisation fähig und können nur fremdbeherrscht werden, weil der Hass sie ohnmächtig macht. Das sind starke Erzählungen und Ideologien. Die nehme ich unter die Lupe.
Die Publizistin Carolin Emcke hat für ihr Buch „Gegen den Hass“ aus dem Jahr 2016 viel Anerkennung bekommen. Geht es nach Emcke, hat Hass in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wie stehen Sie dazu?
Als das Buch 2016 erschien, dachte ich, dass es wichtig ist. Denn es bezieht Stellung gegen Pegida und andere islamfeindliche rechte Strömungen, die damals von der Mehrheit der Gesellschaft entweder belächelt wurden oder denen man bisweilen auch heimlich applaudierte. Als ich das Buch für die Recherche zu „Hass“ noch mal gelesen habe, hat es mich sehr wütend gemacht.
Warum?
Weil auch bei Emcke der Hass als das kategoriale Andere daherkommt. Er ist ultimativ verpönt. Menschen wie ich oder meine Mutter, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, kommen wieder nur als Objekte des Hasses vor. Hassen dürfen sie nicht. Ich nenne diese Herangehensweise das Hufeisen des Hasses. Der Hass der Opfer von Rassismus wird als ebenso schlimm und unangebracht gewertet wie der Hass der Rechten, also der Täter. Emcke schreibt, die Opfer würden sich durch den Hass verformen lassen. Und ich denke: Natürlich lässt man sich durch Hass verformen! Man ist ja keine isolierte Festung und bleibt unangetastet vom Hass, den man erfährt. Menschen wie ich, wie meine Mutter, meine Freundinnen, wir hassen. Und wir haben das Recht dazu. Wir alle wissen, dass sich der Rassismus in unserer Gesellschaft mit Sonntagsreden nicht bekämpfen lässt. Wir müssen stattdessen auf die politischen und sozioökonomischen Ursachen hinweisen.
Ihr Gegenprogramm lautet „strategischer Hass“. Was verstehen Sie darunter?
Ich glaube, dass man mit politischen Gefühlen strategisch umgehen kann. Dass man aus dem Hass Kraft schöpfen kann, ebenso wie aus der Liebe. Politische Bewegungen machen das schon seit Jahrhunderten, weil sie um die Mobilisierungskraft von Gefühlen wissen. Ich will also sagen: Der Hass kann sehr wohl differenzieren. Er kann und muss das Wir, das hinter dem Hass steckt, immer wieder infrage stellen und sich selbst reflektieren. Er kann strategisch eingesetzt werden, um dem Ziel einer radikal zärtlichen Gesellschaft näher zu kommen. Ich arbeite in meinem Buch zwar das widerständige Potenzial des Hasses heraus, aber mir geht es dabei nicht um Hass als Selbstzweck. Auch wenn er ein Nein ist, zur Ungerechtigkeit etwa, muss er mit vielen Jas einhergehen. Und über die Frage, zu was man Ja sagt, müssen wir ins Gespräch kommen.
Titelbild: Harriet Meyer
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.