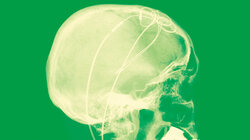fluter.de: Du setzt dich nicht nur in deiner Arbeit als Journalistin mit Mental Health auseinander, du sprichst auch öffentlich über deine Erfahrungen mit Depressionen und ADHS. Warum bist du diesen Schritt gegangen?
Miriam Davoudvandi: Ich bin in einem migrantischen Haushalt in der Kleinstadt aufgewachsen. Da wurde nicht viel über mentale Gesundheit geredet. Nicht weil meine Eltern so verschlossen sind, sondern weil sie zum einen den ganzen Tag arbeiten waren und sich zum anderen niemand Sorgen machen sollte. Ich habe also immer nach einem Ventil gesucht, aber davon, wie psychische Erkrankungen medial aufgearbeitet wurden, war ich saugenervt.
Wovon genau?
Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der jede Woche in den Nachrichten war, dass Britney Spears oder Paris Hilton in Rehab sind – und es wurde immer negativ gelabelt. Warum ist es denn eine negative Nachricht, dass sie sich helfen lassen? Ich habe schon damals nicht gecheckt, warum das so ausgeschlachtet wird. Und der wissenschaftliche Hintergrund hat in der Berichterstattung gefehlt. Das ist häufig heute noch der Fall, und gleichzeitig wird sich über Selbstdiagnosen im Internet lustig gemacht. Wo bleibt denn der Content von Mediziner*innen, von Krankenkassen, vom Gesundheitsministerium? Zwischen fehlender Aufklärung und stigmatisierenden Beiträgen ist es doch klar, dass Betroffene selbst zu Wort kommen möchten.
Ist das nicht ziemlich viel Verantwortung?
Ich glaube, dass wir als Medienmenschen voll die Verantwortung haben, worüber und wie wir über diese Themen berichten und dass es wissenschaftlich fundiert ist. Ich bin natürlich keine Psychotherapeutin. Ich kann nur insofern helfen, als man sich als betroffene Person gesehen fühlt, sich in den Schilderungen anderer Betroffener wiederfindet und vielleicht etwas lernen kann. Heilen werde ich mit meinem Podcast niemanden.
Es wird mehr über psychische Erkrankungen gesprochen, aber wichtige erste Infos fehlen trotzdem oft: Wo gibt’s Hilfe? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Psychotherapeutin und einem Psychiater?
Voll. Es gibt ja zum Beispiel den Service für Patient*innen, der einem bei der Therapiesuche helfen kann, aber das muss man natürlich erst mal wissen. Der Zugang zu Gesundheit, also körperlicher und auch mentaler Unversehrtheit, ist nicht für alle gegeben. Gerade für vulnerable Menschen gibt es so viele Hürden: Menschen, die schwer depressiv sind, können oft nicht mal eben telefonieren oder Mails schreiben. Und wer kann es sich denn zeitlich überhaupt leisten, sich um die eigenen mentalen Probleme zu kümmern und darüber zu sprechen? Da fallen schon ganz viele Menschen raus. Das ist meiner Meinung nach eine Klassenfrage, die viel zu selten gestellt wird. Und da reden wir noch gar nicht darüber, wer dann wirklich im Behandlungszimmer sitzt.
„Wenn Leute sich nicht kaputtarbeiten würden, würde es gar nicht so weit kommen“
Was müsste sich strukturell ändern?
Das Problem Kassensitze: Die Berechnung, wie viele an den jeweiligen Standorten notwendig sind, ist 25 Jahre alt. Es gibt ja nicht zu wenige Psychotherapeut*innen – sondern zu wenige haben einen Kassensitz. Gesetzlich Versicherte müssen es immer zuerst bei Therapeut*innen mit Kassensitz versuchen. Erst wenn die Person das nachweisbar lange genug und erfolglos gemacht hat, kann sie andere Angebote wahrnehmen und dafür die Kosten erstattet bekommen. Und der Bereich Arbeit ist zentral. Wenn Leute sich nicht kaputtarbeiten würden, würde es gar nicht so weit kommen. Aber das versucht man immer abzuwälzen auf den individuellen, privaten Bereich. Achtsamkeitskurse sind ja ein nettes Angebot, aber es braucht eine Grundsicherheit. Wie arbeiten wir? Wie viel arbeiten wir? Wer leidet, auch psychisch, unter Ausbeutungsmechanismen? Wir müssen auch über Geld sprechen. Denn wer kein Geld hat, hat Existenzängste, und wer Existenzängste hat, dem geht’s sehr wahrscheinlich psychisch nicht gut. Auch präventiv wird viel zu wenig gemacht.
Inwiefern?
Wir sollten schon viel früher anfangen, darüber zu sprechen, wie es uns geht. Ich weiß noch, dass wir in der Grundschule immer montags darüber gesprochen haben, was wir am Wochenende gemacht haben. Aber wir haben nie darüber geredet, wie es uns eigentlich geht. Ich glaube, Kindern und Jugendlichen beizubringen, über ihre Gefühle zu sprechen und dass das auch ohne Konsequenzen passiert, wäre ein wichtiger Schritt. Wenn es nach mir geht, wäre Psychologie ein Unterrichtsfach. Es geht dabei ja nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern zum Beispiel auch, Empathie zu lernen. Ich muss und brauche gar nicht immer verstehen, was genau in anderen vor sich geht. Aber ich kann trotzdem für sie da sein und ihre Schilderungen ernst nehmen.
Warum sind psychische Erkrankungen immer noch so stark mit Schamgefühlen verbunden?
Auch wenn wir auf Social Media und in bestimmten Bubbles mehr darüber sprechen, sind psychische Erkrankungen in weiten Teilen der Bevölkerung immer noch tabuisiert. Und sie bedeuten ganz reale Konsequenzen. Psychische Erkrankungen gelten als Risikofaktor und können unter anderem Verbeamtungen im Weg stehen. Oder du kannst nicht einfach in eine private Krankenkasse wechseln. Ich gehe ja sehr offen damit um, aber habe es im Arbeitskontext schon bereut. Mir wurden dann direkt Fragen gestellt: Was glaubst du, wann kannst du wieder arbeiten? Ich merke ständig, dass es Unverständnis gibt, weil ich irgendwo absagen muss oder vielleicht nicht sofort ein klassisches Attest vom Arzt vorweisen kann. Problematisch finde ich auch, dass Gefühle ständig bürokratisiert werden: Warum sind Erfahrungen erst dann valide, wenn sie schwarz auf weiß als Diagnose festgeschrieben sind? Ständig muss für alles irgendein Schriftsatz eingeholt werden.
„Manche sind der Meinung, dass man sich nicht zu sehr auf eine Diagnose versteifen sollte, um sich nicht mit ihr überzuidentifizieren“
Aber Diagnosen sind ja auch wichtig, geben Gewissheit.
Man braucht Diagnosen aus bürokratischen Gründen, um zum Beispiel eine entsprechende Behandlung zu bekommen. Und klar, Diagnosen können sehr beruhigend sein. Ich war oft in der Notaufnahme, weil ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Es war aber eine Panikattacke. Ich glaube, die Erfahrung haben schon viele gemacht. Da hilft es natürlich zu wissen: Okay, es ist das. Gerade bei neurodivergenten Störungen wie ADHS, wo Masking ein Thema ist – also das Verstellen, um im Alltag nicht aufzufallen. Aber: Manche sind der Meinung, dass man sich nicht zu sehr auf eine Diagnose versteifen sollte, um sich nicht mit ihr überzuidentifizieren.
Bei aller Kritik an Selbstdiagnosen: Können diese in solchen Phasen der Ungewissheit hilfreich sein?
Alle meine Verhaltensauffälligkeiten wurden immer auf was anderes geschoben. Dass es tatsächlich ADHS ist, wurde erst viel später diagnostiziert. Auch ich hatte die klassischen Vorurteile wie: ADHS betrifft eher Jungs. TikTok war das, was mich in meiner jahrelangen Vermutung bestärkt hat: Ich habe mich in den Symptomen, die andere dort geschildert haben, wiedergefunden. Die Selbsteinschätzung hat mir geholfen dranzubleiben. Selbst„diagnosen“ können auch eine Überbrückung darstellen bis zur Diagnose oder Therapie, da man diese in diesem Gesundheitssystem nicht so einfach bekommt. Ich bin sehr informiert, was das Thema angeht, und trotzdem habe auch ich riesige Schwierigkeiten, einen Therapieplatz zu finden. Therapiesuche ist oft ein Teilzeitjob. Ich habe Nummer über Nummer angerufen, die Therapeut*innen und Psychiater*innen hatten zum Teil Wartezeiten von zwei Jahren. Jetzt fahre ich jeden Monat zwei Stunden raus nach Brandenburg in eine Klinik, die auch erst mal privat zu bezahlen ist. Selbstdiagnosen sind auch da wichtig, wo Fehldiagnosen stattfinden oder es gar nicht erst zu einer kommt. Nicht nur das Geschlecht ist dafür ausschlaggebend, sondern auch, ob man auch noch eine Person of Color ist. So werden bei rassifizierten Personen häufig Erkrankungen nicht erkannt, dafür Gefühle wie Wut pathologisiert.
„Mir hat es sehr geholfen, einmal in der Woche alles rauszulassen. Und dann zu versuchen, mich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren“
Mit der Erkenntnis, dass man psychische Probleme hat, platzt häufig auch die Vision, die man von sich in der Zukunft hatte, oder es fällt schwerer, sich überhaupt die eigene Zukunft zu denken. Was hat dir geholfen?
Die meiste Zeit meines Lebens konnte ich mir nicht mal vorstellen, was ich in der darauffolgenden Woche mache. Entsprechend habe ich mich auch nicht getraut zu träumen. Das hat sich erst in den letzten Jahren geändert, wobei es nicht den einen Wendepunkt gab. Es kam im Laufe der Jahre langsam durch die Therapie. Mir hat es sehr geholfen, einmal in der Woche all die Traumata zu bearbeiten und alles rauszulassen. Und dann zu versuchen, mich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren. Irgendwann gab es diesen Moment – ich erinnere mich noch sehr gut daran –, da saß ich auf meinem Schreibtisch und musste eigentlich arbeiten. Die Sonne schien rein, einer meiner Lieblingssongs lief und ich war so: Boah, eigentlich mag ich das Leben schon sehr. Ich war zwar gleichzeitig auch traurig, dass ich es so oft nicht schaffe, diese Momente zu genießen. Aber manchmal eben doch.
Auch mit psychischen Problemen kann das Leben gut sein.
Es wird zu selten kommuniziert: Vieles ist heilbar. Oder man kann zumindest einen Umgang lernen, sodass der Alltag viel weniger eingeschränkt wird. Therapie bedeutet ja Hilfe zur Selbsthilfe. Und auch wenn der Begriff „Akzeptanz“ abstrakt und esoterisch schon kaputtbenutzt wurde, ist Akzeptanz einfach so wichtig. Mir fällt es selbst voll schwer, und ich denke mir oft, warum kannst du nicht anders sein? Aber zu akzeptieren, dass es einem erst mal so geht, ist der erste Schritt zur Besserung.
Miriam Davoudvandi ist freie Journalistin, Moderatorin, Autorin und DJ mit iranischen und rumänischen Wurzeln. Sie arbeitet viel im Bereich Musikjournalismus. In ihrem Podcast „Danke, gut“ spricht sie mit Personen aus der Öffentlichkeit sowie Expert*innen über mentale Gesundheit. Paula Hartmann, Casper oder Sarah Wagenknecht waren u.a. schon zu Gast.
Portrait: Bahar Kaygusuz
Titelbild: Philotheus Nisch / Yannick Schuette – Connected Archives