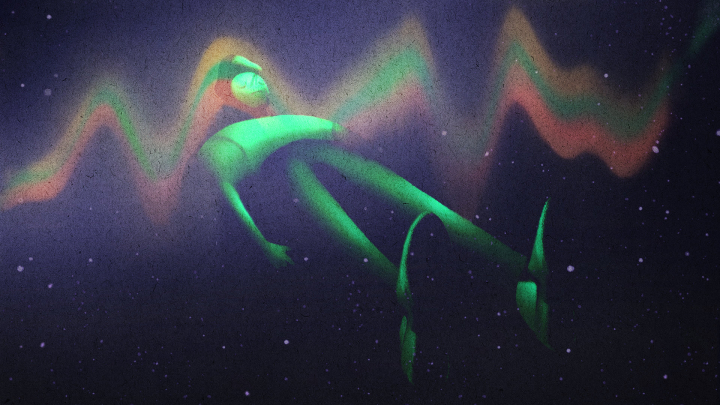Leere Schulbänke
In Japan nehmen sich immer mehr Jugendliche das Leben. Wie erklärt sich dieser traurige Trend – und was lässt sich dagegen tun?
Mitte Oktober wurde das Thema, das jeder vor Augen hat, aber kaum jemand sehen will, wieder allgegenwärtig. Zeitungen machten damit auf, das Morgenfernsehen diskutierte in Expertenrunden. Denn diesmal ging es um einen Fall besonderer Tragweite. Die Agentur H Project, die mit den von ihr vermarkteten Popgruppen eigentlich zur Illusion einer heilen Welt in den japanischen Medien beiträgt, hatte plötzlich eine Klage am Hals. 92 Millionen Yen (gut 700.000 Euro) forderten die Eltern von Honoka Omoto, die bis zu ihrem Tod im März in der Girlgroup Enoha Girls gesungen hatte. Der Vorwurf: Die Talentagentur sei schuld am Tod der 16-Jährigen.
Der Sozialpsychologe Jiro Ito versucht Jugendliche via Internet vom Suizid abzuhalten. Wie genau, erklärt er im Interview
Als Reaktion auf ihren harten Alltag voller Verpflichtungen und Mobbing hatte sich Honoka Omoto, Schülerin und Teeniestar, erhängt. Die bei Events anfallenden zehn Stunden Arbeit am Tag zusätzlich zur Schule hielt sie nicht mehr aus, wollte die Gruppe verlassen, obwohl eine Showkarriere ihr Traum gewesen war. Als sie diese Probleme beim Management ansprach, soll sie erpresst und bedroht worden sein: Sie solle sich loyal gegenüber ihren Bandkolleginnen verhalten und weitermachen, ansonsten käme sie in Schwierigkeiten. Dass Omotos Hinterbliebene ihren Fall detailreich öffentlich gemacht haben, erinnert nun Japan an ein Problem, vor dem viele lieber die Augen verschließen würden: den starken Anstieg der Suizidrate unter Jugendlichen.
Anders als in christlich und islamisch geprägten Ländern ist ein Suizid in der japanischen Geistesgeschichte keine Sünde, sondern wurde traditionell eher als ein Übernehmen von Verantwortung oder eine Bitte um Vergebung verstanden. Bekannt ist auch der Mythos der Samurai, die sich in ausweglosen Situationen aus Ehrgefühl das Leben nahmen, oder die Geschichte der Kamikaze genannten Selbstmordpiloten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Einer der berühmtesten Schriftsteller Japans, Yukio Mishima, nahm sich 1970 öffentlichkeitswirksam das Leben. Durch internationale Medien geistern Storys über den „Selbstmordwald“ am Rande des Fuji, wohin einige Menschen gehen, um sich aufzuhängen. Laut der Weltgesundheitsorganisation liegt Japans Suizidrate über 70 Prozent über dem weltweiten Durchschnitt: Nahmen sich 2016 durchschnittlich rund zehn von 100.000 Menschen das Leben, waren es in Japan über 18 (und in Deutschland über 13).
Nachdem die Suizidrate in den 1990er-Jahren als Folge der schweren ökonomischen Krise stark angestiegen war, fallen die Werte im Bevölkerungsdurchschnitt mittlerweile. Besonders deutlich ist dieser Trend seit 2012, als die Regierung das Thema als soziales Problem anerkannte, vermehrt Sorgentelefone einrichtete und den mentalen Zustand von Angestellten in Betrieben überwachen ließ. 2016 zählte Japan 21.897 Suizide. Dies markierte das siebte Jahr in Folge mit fallenden Werten und nur noch gut zwei Drittel des Höchstwerts von 34.427 im Jahr 2003.
Die Telefonseelsorge der Regierung erreicht nur wenige Jugendliche – den meisten ist telefonieren fremd
Doch fragt man Jiro Ito, gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Vor fünf Jahren gründete der ausgebildete Sozialpsychologe in Tokio die Nichtregierungsorganisation OVA. Der Name steht für den Plural des lateinischen Wortes für Ei und deutet auf die Zerbrechlichkeit der Menschen hin. Mit OVA will Ito auf Suizide junger Menschen aufmerksam machen. Denn dieser Anteil stieg über die letzten Jahre an, die Sängerin Honoka Omoto ist nur ein Fall von vielen.
Auf 100.000 Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren kamen in Japan 2015 circa sieben Suizide pro Jahr (Deutschland: knapp fünf). Seit 2014 ist dies die häufigste Todesursache unter Teenagern. „Die Kampagne, mit der die Regierung Selbstmorden vorbeugen will, erreicht junge Leute überhaupt nicht“, sagt Ito. Ein Großteil der Betroffenen würde bei seelischen Problemen sowieso kaum bei einer Hotline anrufen. „Telefonieren ist unter jungen Leuten heute eher etwas Anstrengendes oder sogar Unheimliches. Man nutzt Messaging-Dienste.“
Ein häufiger Grund, warum sich Schüler*innen das Leben nehmen: Mobbing
Immer Anfang September und Anfang April, wenn nach den Ferien die Schule wieder beginnt, steigt die Suizidrate etwas an. Laut einer Untersuchung von Kenzo Denda, Professor für Gesundheitswissenschaften an der Universität Hokkaido, leidet jedes vierte Kind auf einer weiterführenden Schule unter Depressionen. Häufig sei Mobbing ein Grund dafür, und unter depressiven Kindern sei Suizid wiederum besonders häufig.
Chika Tsuda, eine Lehrerin im zentral gelegenen Kobe, glaubt, die wesentlichen Probleme zu kennen. „Jugendliche sind von morgens bis abends in der Schule, dort wird gegessen und Sport oder Musik gemacht. Ihr einziges weiteres soziales Umfeld ist das Elternhaus.“ Wer also in der Schule soziale Probleme habe, könne diese meist nur daheim ansprechen, wovor aber viele junge Menschen aus Angst, die Eltern zu enttäuschen, zurückschreckten. Zudem: „Es gibt großen Druck in unserer Gesellschaft, normal zu sein. Anderssein wird kaum geschätzt.“ Konformität zu fördern sei heutzutage zwar meist nicht mehr die Absicht der Lehrer, glaubt Tsuda, der Druck werde aber häufig aus den Familien durch die Kinder in den Schulalltag getragen. Und wer von der Norm abweicht, ob durch die Noten oder den Haarschnitt, kann zum Mobbingopfer werden.
Lehrer versuchen Mobbing zu verhindern. Nur: Oft kriegen sie nichts davon mit
Müsste die Schule dies nicht erkennen und einschreiten? Ja, wenn sie es könnte, meint Jiro Ito von der NGO OVA. „Natürlich gibt es die Fälle, in denen Schulen wie auch Arbeitgeber die Probleme im eigenen Haus verschweigen, um die Reputation zu schützen. Aber häufiger ist der Fall, dass die Lehrer davon gar nichts mitbekommen.“ Chika Tsuda kennt dies aus ihrem Alltag. „Wenn Schüler im Unterricht gehänselt oder während der Pause in den Mülleimer gesteckt werden, dann sehen wir Lehrer das natürlich. Aber wie sollen wir deren Chatgruppen überwachen?“
Und wenn es tatsächlich einen Suizid gegeben habe, erführe man nicht einmal als Lehrer unbedingt davon. Dann komme ein Kind eben nicht mehr zur Schule. „Man macht sich dann seine Gedanken“, sagt Tsuda, die solche Geschichten von Kollegen kennt. „Aber es kann gut sein, dass die Eltern so ein unangenehmes Ereignis auch nicht zum großen Thema machen wollen.“
Der Fall der Popsängerin Honoka Omoto hat auch deswegen so hohe Wellen geschlagen, weil hier die Öffentlichkeit auf Missstände aufmerksam gemacht wurde. Doch wer kann etwas ändern? OVA testet neue Wege. Bei Google hat Jiro Ito Anzeigen geschaltet, die immer dann aufscheinen, wenn Begriffe wie „shinitai“ (dt.: ich will sterben) oder „jisatsu houhou“ (dt.: Suizidmethoden) eingegeben werden. Ganz oben steht bei Google dann ein Link mit dem Titel „Für dich, der/die du über Freitod nachdenkst“, der auf eine Website mit Ermunterungen und Gesprächsangeboten weiterleitet.
Ito ist guter Dinge, dass sich damit etwas erreichen lässt: „Der Anteil der Personen, die den Link sehen und dann auch draufklicken, ist doppelt so hoch wie bei normalen Anzeigen.“ Im ersten Jahr hat OVA auf diese Weise allein im Westen von Tokio 300 E-Mails von Menschen erhalten, die über einen Suizid nachdachten. „Die meisten lassen sich von uns überzeugen, es mit dem Leben noch einmal zu versuchen.“ Die Unterhaltungen führt OVA natürlich per Messaging-Dienst.
Wenn es dir nicht gut geht oder du gar daran denkst, dir das Leben zu nehmen, versuche, mit Freunden oder Verwandten darüber zu sprechen. Es gibt auch sehr viele Hilfsangebote, bei denen du dich rund um die Uhr melden kannst.
Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und jederzeit erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Wenn du lieber chattest oder E-Mails schreibst, kannst du unter www.telefonseelsorge.de unkompliziert schriftlich Kontakt aufnehmen.
Titelbild: Pieter Ten Hoopen/VU/laif