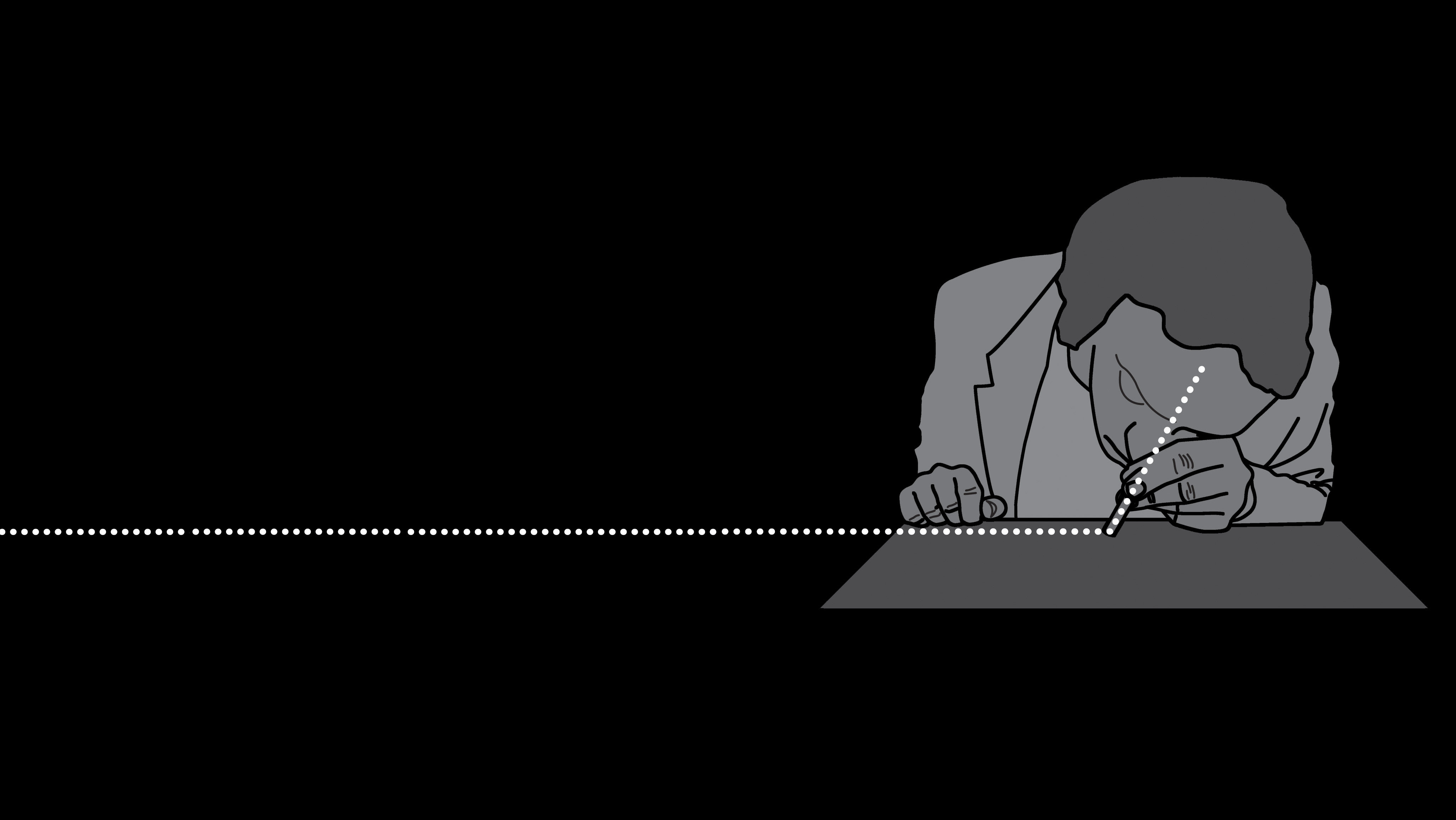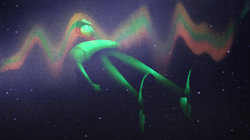Speed, Ecstasy, LSD, Ketamin, Kokain: In ihrer Studienzeit in Basel konsumiert Amelie fast jedes Wochenende. Wie hoch die Drogen dosiert sind, in welchem Verhältnis also Wirk- und Streckstoff stehen, interessiert sie damals schon. Fragen kann Amelie aber allenfalls die Personen, von denen sie kauft – die wiederum die fragen, von denen sie kaufen. „Ich habe meinen Dealern vertraut“, sagt Amelie, die eigentlich anders heißt und aus dem deutsch-schweizerischen Grenzgebiet kommt. „So macht man das halt.“
Das Vertrauen ist riskant. Welche Substanzen genau in den Drogen enthalten sind – ob sie beispielsweise zu hoch dosiert oder sogar mit giftigen Stoffen verunreinigt sind –, wissen die Konsumierenden in der Regel nicht. Und das kann gefährlich werden. Immer wieder sterben Menschen an einer Überdosis oder Vergiftung. Auch Amelie hat schon überdosiert: „Nach einer Ecstasy-Pille musste ich mich übergeben, mein Magen war übersäuert, mir wurde heiß und kalt, ich konnte nicht mehr richtig sehen.“ Sie glaubt, dass die Pille damals weit höher dosiert war, als man ihr beim Kauf gesagt hatte.
Legales Drug-Checking ist in Deutschland fast unmöglich
In manchen europäischen Ländern gibt es daher Anlaufstellen für sogenanntes Drug-Checking: Konsumierende können ihre Drogen anonym in mobilen oder stationären Teststellen abgeben, auf Wirkstoffe überprüfen oder in ihrer Zusammensetzung analysieren lassen. Viele Stellen bieten auch Termine an, in denen die Ergebnisse und die damit verbundenen Risiken besprochen werden. So können Konsumierende entscheiden, ob sie den Stoff vernichten lassen oder nach wie vor einnehmen wollen.
In Deutschland gibt es bisher kein bundesweites Drug-Checking-Angebot – trotz wiederholter Bemühungen. Schon 1995 führte der Berliner Verein Eve & Rave eine Initiative zur Qualitätsüberprüfung von Drogen ein. Die Ergebnisse der Analysen veröffentlichte der Verein auf Flyern, in Infobriefen, später auch online – damit Konsumierende in ganz Deutschland ihre Pillen abgleichen konnten. Rund anderthalb Jahre später musste Eve & Rave das Programm wieder beenden. Das Landeskriminalamt hatte ermittelt, drei Vereinsmitglieder wurden angeklagt: Sie sollen unerlaubte Substanzen besessen haben ohne eine schriftliche Erlaubnis für den Erwerb. Es handelte sich um die Drogen, die sie im Rahmen des Programms untersucht hatten.
ezgif.com-gif-maker.gif

Später urteilt das Gericht, dass Mitarbeitende des Drug-Checking-Programms die Drogen zum „Zweck der Analyse“ entgegennehmen durften. Die allgemeine Rechtslage und das Betäubungsmittelgesetz stehen flächendeckendem Drug-Checking aber bis heute im Weg: Der Besitz illegaler Substanzen bleibt auch im Rahmen entsprechender Programme untersagt. Eine betäubungsmittelrechtliche Ausnahmeerlaubnis hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für Drug-Checking-Projekte bisher noch nicht erteilt, erklärt die Behörde auf fluter-Anfrage. Ohne solche Ausnahmeerlaubnisse oder eine Änderung im Betäubungsmittelgesetz ist Drug-Checking in Deutschland nahezu unmöglich.
Ein Schlupfloch fand ein Drug-Checking-Pilotprojekt, das aktuell in Thüringen läuft. Dort bereiten die Konsumierenden die Testproben selber vor, sodass die Mitarbeitenden von SubCheck keine Betäubungsmittel, sondern lediglich die zerlegten Substanzen in den Händen halten.
Weiterziehen
Von der Plantage bis in die Nase: Diese Infografiken zeigen, wie Kokain produziert, geschmuggelt und verkauft wird
In anderen europäischen Ländern funktioniert das Drug-Checking ohne solche Umwege: In den Niederlanden gibt es Drug-Checking-Programme bereits seit den späten 1980er-Jahren, in Österreich und in der Schweiz laufen ähnliche Projekte seit Jahren. So können die Behörden vor Ort besser auf Konsumtrends und -gefahren reagieren: Im Austausch mit den Testzentren können sie offizielle Warnungen vor überdosierten Pillen herausgeben, Krankenhäuser informieren, die Aufklärungsarbeit und Präventionskampagnen entsprechend anpassen. In der Schweiz funktioniert das schon gut: Die Schweizerische Fachstelle Sucht beispielsweise informiert regelmäßig über den Markt für Partydrogen. Sie stützt sich dabei nicht nur auf Drug-Checking-Ergebnisse aus der Schweiz, sondern auch aus Tschechien, Österreich oder den Niederlanden.
Amelie hat hin und wieder selbst Drug-Checking-Stellen in Basel oder Zürich aufgesucht. Manche hätten direkt auf Partys oder vor Clubs haltgemacht, erzählt sie. In Zürich liege die Drogen-Teststelle mitten in der Stadt. Der Prozess sei einfach gewesen: online einen Termin machen oder die Drogen einfach zur Sprechzeit vorbeibringen. Nach einem Aufklärungsgespräch entnahmen die Mitarbeitenden eine winzige Probe der Drogen und vergaben eine Nummer. Die konnte Amelie wenige Tage später auf einer Website eingeben, um ihr Ergebnis zu erfahren. Sie blieb anonym. Amelie hat damals Kokain und Ketamin testen lassen, vor allem, um zu erfahren, wie hoch die Dosierung war. Neben sauberen Teströhrchen habe sie auch Infoflyer zu den Nebenwirkungen unterschiedlicher Drogen bekommen. „Ich habe mich als Konsumentin irgendwie ernst genommen gefühlt.“
Aufklärung auf Augenhöhe funktioniere oft besser als Strategien, die potenziellen Konsumierenden Angst machen oder Abstinenz predigen sollen, hebt auch die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) hervor. Gerade gegenüber jungen und unregelmäßig Konsumierenden. Durch die Präventionsarbeit und die genaue Darstellung der Zusammensetzung erreiche man auch Bevölkerungsgruppen, die von herkömmlichen Kampagnen nicht angesprochen werden, heißt es in ihrem Bericht über Drug-Checking.
Vermittelt das Drug-Checking falsche Sicherheit?
So überzeugt wie die EBDD sind nicht alle. Wer Drogen ohne jede Warnung aus der Analyse zurückbekomme, so das Hauptargument der Gegner und Gegnerinnen, könnte ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt bekommen. Außerdem motiviere das Angebot ganz allgemein dazu, mehr zu konsumieren oder grundsätzlich damit anzufangen.
Internationale Studien kommen zu anderen Ergebnissen. Und im neuen Koalitionsvertrag einigten sich SPD, Grüne und FDP darauf, dass Drug-Checking auch in Deutschland „mit Modellprojekten vorbereitet“ werden soll. Ein Testlauf für bundesweite Drug-Tests, Amelie findet das richtig. Sie wünsche sich heute manchmal, weniger leichtsinnig mit Drogen in Berührung gekommen zu sein, erzählt sie. Das Bundesgesundheitsministerium schätzt, dass in Deutschland rund 600.000 Menschen einen mindestens „problematischen Umgang“ mit illegalen Drogen haben (Cannabis, das am meisten konsumiert wird, eingeschlossen). Dazu kommen etliche Gelegenheitskonsumierende. Die Aufgabe der Politik, findet Amelie, ist es nicht, den Konsum zu verurteilen, sondern ihn sicherer zu machen.
Dass Drug-Checking dabei eine zentrale Rolle spielen kann, zeigte gleich die erste Testreihe aus dem Thüringer SubCheck-Projekt. Bei 69 Proben waren zwei Drittel der Ecstasy-Proben überdurchschnittlich hoch dosiert und ein knappes Drittel der Speed-Proben verunreinigt.
GIFS via GIFER