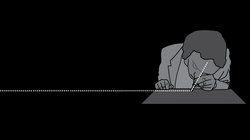„Chiara“, so viel schon mal vorweg, ist kein typischer Mafiafilm. Es liegen keine blutigen Pferdeköpfe unter Bettdecken, niemand plant bei Pastagelagen Morde, in zwei Stunden explodiert nur ein einziges Auto. Was man stattdessen sieht: wie die Hauptfigur, die 15-jährige Chiara, mit ihrer Familie auf der Wohnzimmersofalandschaft fernsieht, wie sie im Fitnessstudio auf dem Laufband schwitzt und auf der Promenade der kalabrischen Hafenstadt Gioia Tauro mit ihren Freundinnen abhängt.
Dass all das so unspektakulär aussieht, wie es klingt, beinahe dokumentarisch, liegt daran, dass Regisseur Jonas Carpignano in seiner Arbeit Realität und Fiktion eng verschränkt: Carpignano, Sohn einer US-Amerikanerin und eines Italieners, lebt seit vielen Jahren selbst in Gioia Tauro. In insgesamt drei Spielfilmen („Chiara“ ist der letzte unter ihnen), erforscht er diesen Teil Süditaliens, in dem die Arbeitslosigkeit hoch und der Einfluss der ’Ndrangheta groß ist. Die kalabrische Mafiaorganisation gilt als die mächtigste, der Hafen von Gioia Tauro als einer der wichtigsten Umschlagplätze für Drogen und Waffen in Europa.
Niemand will erklären, was los ist, also macht sich Chiara selbst auf die Suche
Carpignano kennt also die Lebenswelt, von der er erzählt, und seine Schauspieler:innen kennen sich: Chiaras Familienmitglieder sind auch in Wirklichkeit die Familienmitglieder der Hauptdarstellerin Swamy Rotolo. Carpignano ließ die Darsteller:innen über weite Strecken improvisieren. Das Resultat sind Szenen, die mitunter Längen haben, aber einen Familienalltag zeigen, der in seiner Mischung aus Zärtlichkeit und Genervtheit sehr authentisch rüberkommt.
Umso schmerzhafter wirkt es, als dieser Alltag plötzlich dahin ist: Eines Nachts verschwindet Chiaras Vater. Kurze Zeit später steht die Polizei vor der Tür, in den Nachrichten heißt es, der Vater sei Teil der ’Ndrangheta und befände sich auf der Flucht. Niemand aus Chiaras Familie will erklären, was los ist. Also macht sich Chiara selbst auf die Suche.
Ab hier nimmt der Film Tempo auf, Chiara stößt auf geheime Bunker und Rauschgiftoperationen. Die eigentliche Frage, die Carpignano interessiert, ist aber, was Chiara mit ihren Erkenntnissen anfängt: Akzeptiert sie, dass sie Teil einer Mafiafamilie ist? Oder versucht sie, aus ihr auszubrechen?
Dass Chiara so oder so einen Preis zahlt, versteht man spätestens, als sie eine Schulkameradin mit einem brennenden Böller bewirft – aus kalter Wut, ohne eine Miene zu verziehen. Plötzlich realisiert man, dass Chiaras Welt schon vor diesem Gewaltausbruch nicht so heil war, wie sie aussah. War da nicht der Onkel, der Chiara anschrie, sie dürfe nicht rauchen, weil sie ein Mädchen sei? Oder die Mutter, die ihr eine runterhaute, als Chiara sie fragte, ob der Vater Teil der Mafia sei? Die Atmosphäre aus Angst, Aggression und Hoffnungslosigkeit, die in Gioia Tauro herrscht, durchdringt auch die Bilder des Films: Ausgewaschen wirken die Farben, karg die Landschaften, selbst das Meer, das ab und zu hinter den brüchigen Betongebäuden durchschimmert, ist nur ein blauer Streifen, der nichts von Weite oder Leben hat.
Mafia, will Carpignano klarmachen, hat auch etwas mit der Klassenfrage zu tun
Chiara bekommt die Möglichkeit, diese Welt zu verlassen: Nachdem sie ihre Klassenkameradin verletzt hat, entscheiden die Behörden, sie im Rahmen eines Mafia-Ausstiegsprogramms aus ihrer Familie zu nehmen. Solche Programme gibt es in Italien tatsächlich. Sie sind umstritten, gelten aber als erfolgreich dabei, Kinder dem organisierten Verbrechen zu entreißen und vor der Gewalt zu schützen, die Mafiaaussteiger:innen normalerweise droht.
Was das angeht, hat Chiara nichts zu befürchten: Als sie ihren Vater endlich aufspürt, rät er ihr, an dem Programm teilzunehmen. Der Vater, das legt der Film nahe, ist ein kleines Rad im Getriebe des Verbrechens, ein Mann ohne große Bildung, der seine Familie liebt und – in seinen Augen – aus reiner Notwendigkeit heraus kriminell wurde. „Sie nennen es Mafia, wir nennen es Überleben“, sagt er an einer Stelle. Ohne ihn zu entschuldigen, will Carpignano klarmachen, dass die Mafia in Süditalien auch aufgrund der Armut so stark werden konnte und dass dabei auch heute noch die Klassenfrage eine Rolle spielt: Die Pflegemutter, zu der Chiara geschickt werden soll, lebt im reichen Norden und ist Ärztin. Es scheint, als bleibe Chiara nur die Wahl zwischen einem Leben mit der Kriminalität oder ohne die Menschen, die sie liebt. Eine Aussicht, die so deprimierend ist, dass man sich fast die Hollywoodwelt der blutigen Pferdeköpfe und explodierenden Autos herbeiwünscht.
„Chiara“ läuft ab dem 23. Juni in den deutschen Kinos und ab dem 26. August bei dem Streamingdienst Mubi.
Titelbild: Frenetic Films