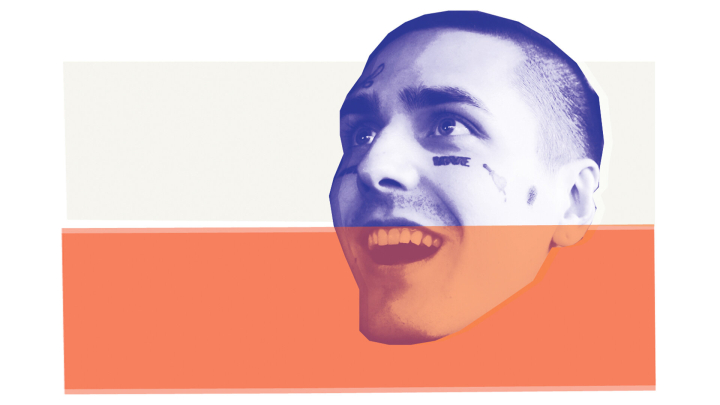Sound of da Police
Jamie und Daniel sind bei der Polizei. Und hören Rap. Geht das zusammen?
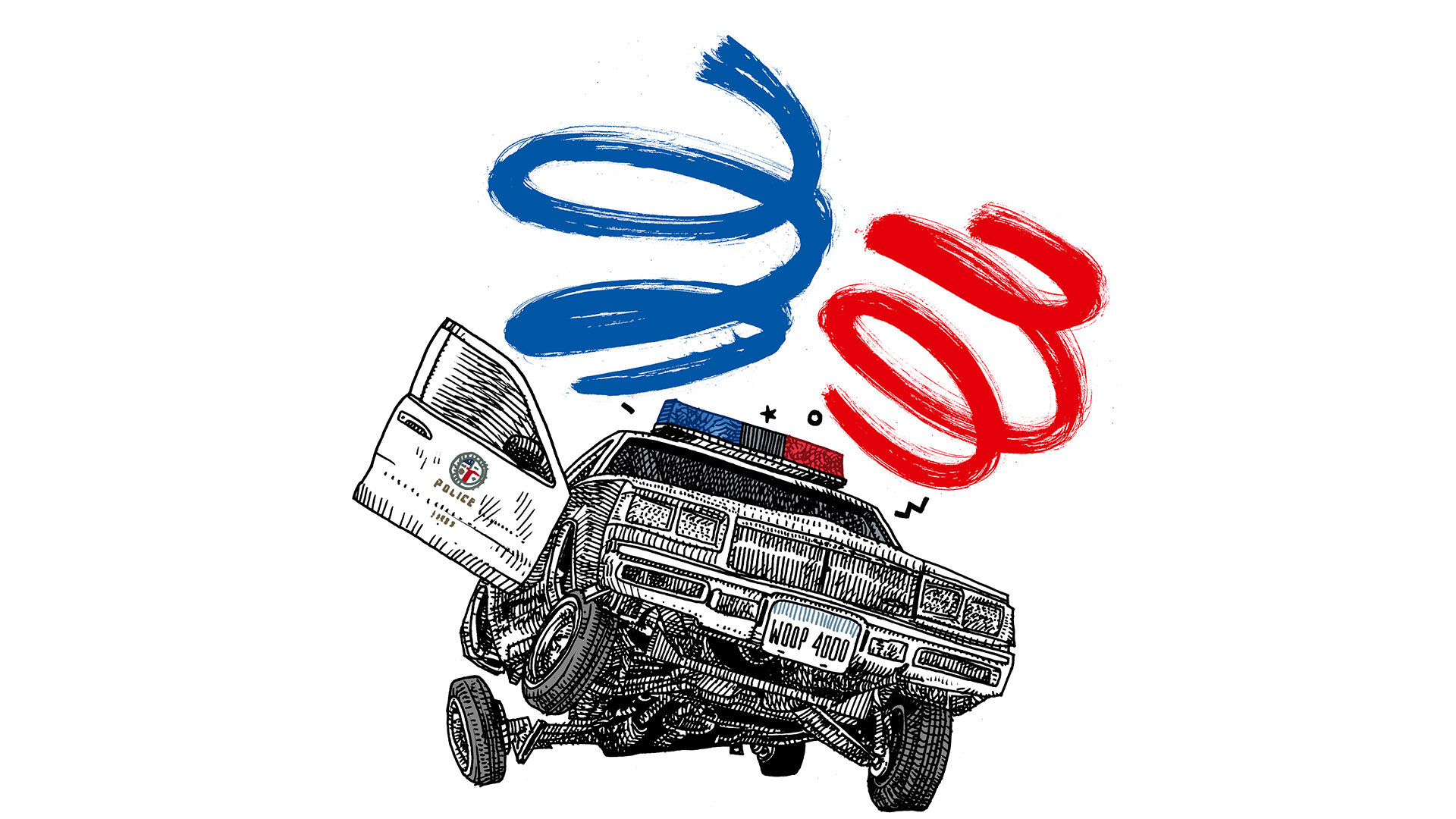
Deutschen Rap zeichnet 2024 vor allem eines aus: Er legt sich nicht fest. Rap ist Pop, manchmal politisch, manchmal nicht, auf Konzerten wird geravt, gepogt und getwerkt, die Stars tragen mal Skibrillen, mal Sturmmasken und sind immer häufiger auch Frauen. An einer Tradition aber hält Rap fest: Der Polizei zeigt man den Mittelfinger.
Dafür gibt es viele Gründe. Zunächst begann Rap als Kultur der Unterdrückten, der Underdogs, die rappten, um sich bei denen Gehör zu verschaffen, die ihnen wegen ihrer Hautfarbe, Schulabschlüsse und Kontostände nicht zuhörten. Vom Rassismus und der strukturellen Polizeigewalt in den USA erzählen Rapper seit den 1980er-Jahren, gerade der schnell populär werdende Gangsta-Rap arbeitete sich an den „Cops“ ab.
[...] ’cause I’m brown
And not the other color so police think
They have the authority to kill a minority
Fuck that shit, ’cause I ain’t the one
For a punk motherfucker with a badge and a gun
In Deutschland folgten Acts wie Advanced Chemistry in den 1990er-Jahren den US-Vorbildern. Größen wie Haftbefehl und Newcomer wie Aylo oder Lacazette führen die Tradition polizeikritischer Texte bis heute fort. „Die sind durchaus politisch zu verstehen“, sagt der Kriminologe Christian Wickert. „Rap kann polizeiliches Fehlverhalten wie Racial Profiling, Korruption oder eine als illegitim empfundene Gewaltanwendung skandalisieren.“ In einer Studie unter Zehntausenden Polizeibeschäftigten gab jüngst ein Drittel an, aus dem Kollegium bereits rassistische und sexistische Äußerungen oder ablehnende Kommentare gegenüber Asylsuchenden gehört zu haben. Stereotype und strukturelle Benachteiligung sind nicht nur in den USA ein Problem, sondern auch in Deutschland.
Für ein Forschungsprojekt hat Christian Wickert Texte von mehr als 900 Deutschrap-Alben analysiert, die zwischen März 2015 und März 2022 in die Charts eingestiegen sind. Er hat dabei herausgearbeitet, warum das „Copbashing“ zum Selbstverständnis vieler Rapperinnen und Rapper dazugehört. Neben der politischen Komponente macht Wickert die Street Credibility verantwortlich, die gerade im Straßen- und Gangsta-Rap eine wichtige Währung ist. Erzählungen vom Kontakt mit der Polizei würden die Texte und das Image beglaubigen, sagt Wickert: Wer nicht nur darüber rappt, sondern wirklich krumme Dinger dreht, bekommt es zwangsläufig irgendwann mit der Polizei zu tun. Das Scheinwerferlicht der Unterwelt leuchtet immer auch blau.
Zum anderen sei Polizeikritik häufig versteckte Sozialkritik, sagt Wickert. Rap erzählt oft aus Gegenden ohne Bildungs- und Aufstiegschancen. „Gangsta-Rapper stellen dort ihre Handlungsfähigkeit zur Schau, indem sie diesen widrigen Umständen wie der Verfolgung durch die Polizei aus eigener Kraft entkommen.“
Aber wie ist es umgekehrt? Natürlich sind auch viele Polizeibeamtinnen und -beamte selbst Fans der Musik, die sie ablehnt. Wie hält man diesen Widerspruch aus? „Es gibt Teile von Rap, die kann man mögen, und andere nicht“, sagt Daniel, 34, der viele Jahre Streife durch Berlin gefahren ist. „Ich höre genauer hin, wenn eine Line über Polizisten fällt, aber ich liebe Rapmusik und ihre Protagonisten nicht weniger, seit ich Polizist bin.“ Jamie sieht das ähnlich. Sie ist 31 und arbeitet nach sieben Jahren auf Streife mittlerweile im gehobenen Dienst der Polizei. „Ich liebe die Sprache und welche Geschichten Rap daraus baut. Oft adressiert er die richtigen strukturellen Probleme wie Armut oder Rassismus. Es ist aber auch wichtig, wie man die rüberbringt.“
Fick auf die Bull’n, wir machen Party [...]
Mitten in der Nacht siehst du Blaulicht am Block
Weil einer nimmt was,
verpackt es um und gibt es dann weiter
Jeden Tag Streiterei’n wegen Baida oder Weibern
Fick Polizei, Mann, transportier’ Ganja auf higher
„Fick dich“ von Hanybal und Nimo
Bloßes Abgehate auf die Polizei langweile sie, sagt Jamie. „Aber man hört Rap anders, wenn man sich mit den Künstlern beschäftigt. Der klassische ‚Fick die Cops‘-Song von Haftbefehl nervt mich wegen seiner Biografie weniger als einer von Bushido, der sich mit dem Chef eines kriminellen Clans verkracht hat und deshalb massiv den Polizeiapparat in Anspruch nehmen musste.“
Rap – insbesondere Gangsta-Rap – ist eben vor allem: Show. Nicht die „Tagesschau“ oder der polizeiliche Lagebericht, sondern eine Kunstform, in der die Inszenierung zählt. „In dieser Hinsicht brauchen Rapper die Polizei“, sagt der Kriminologe Christian Wickert. Auch wenn es viele ungern zugeben würden. Die Musik ist zum globalen Phänomen geworden, weil sie gute Geschichten erzählt. Jede gute Geschichte hat zunächst mal einen Protagonisten und einen Antagonisten.
„Da wird vieles überzogen dargestellt“, sagt Daniel. Die Texte spiegeln aus seiner Sicht nicht die Realität der Polizeieinsätze wider: Eine Verkehrskontrolle oder der zwölfte Einsatz wegen Lärmbelästigung wären viel zu nüchtern für große Geschichten. Das wüssten auch Rap-Fans, sagt Daniel. Dass die polizeikritischer sind als Fans anderer Genres, glaubt er nicht. Wie man die Polizei sehe, bestimmen nicht die Texte, die man hört, sondern die Erfahrungen, die man mit Polizisten macht.
Görlitzer Park, Görlitzer Park
Auf dem Spielplatz liegen Nadeln im Sand
Racial Profiling, Schikane vom Staat
Drogenspürhunde, sie wittern etwas
Daniel fühlt den Song – vielleicht mehr, als manche vermuten mögen. „Man sollte ansprechen, was schlecht läuft, auch in der Polizei“, sagt er. Künstler wie K.I.Z. oder Apsilon würden das gut hinbekommen. Als Polizist ist er verpflichtet, die Regeln eines Staates durchzusetzen, die die Würde aller Menschen schützen sollen. Gleichzeitig lasse die Politik viele Menschen so allein, dass sie irgendwann kriminell werden. Als Polizist habe er sich damit oft im Stich gelassen gefühlt. „Aber es gibt Texte, die mir helfen, die Gründe für manche Straftaten nachzuvollziehen. Rap kann dir manchmal erklären, wen du vor dir hast, wie die Welt dieser Person aussieht, wie du ihr am besten begegnest.“
Auch wenn man im Rap traditionell nicht mit der Polizei spricht: zu ihr zu sprechen ist kein Verbrechen. Vielleicht ist es eine Chance.
Illustration: Sebastian Haslauer
Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 93 „Rap“ erschienen.
Das ganze Heft findet ihr hier.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.