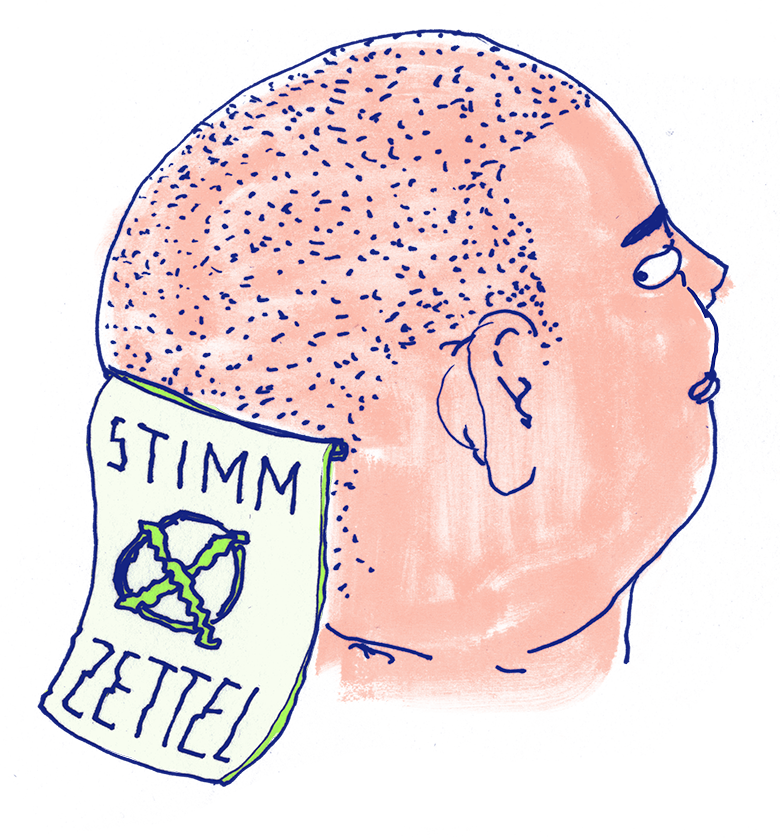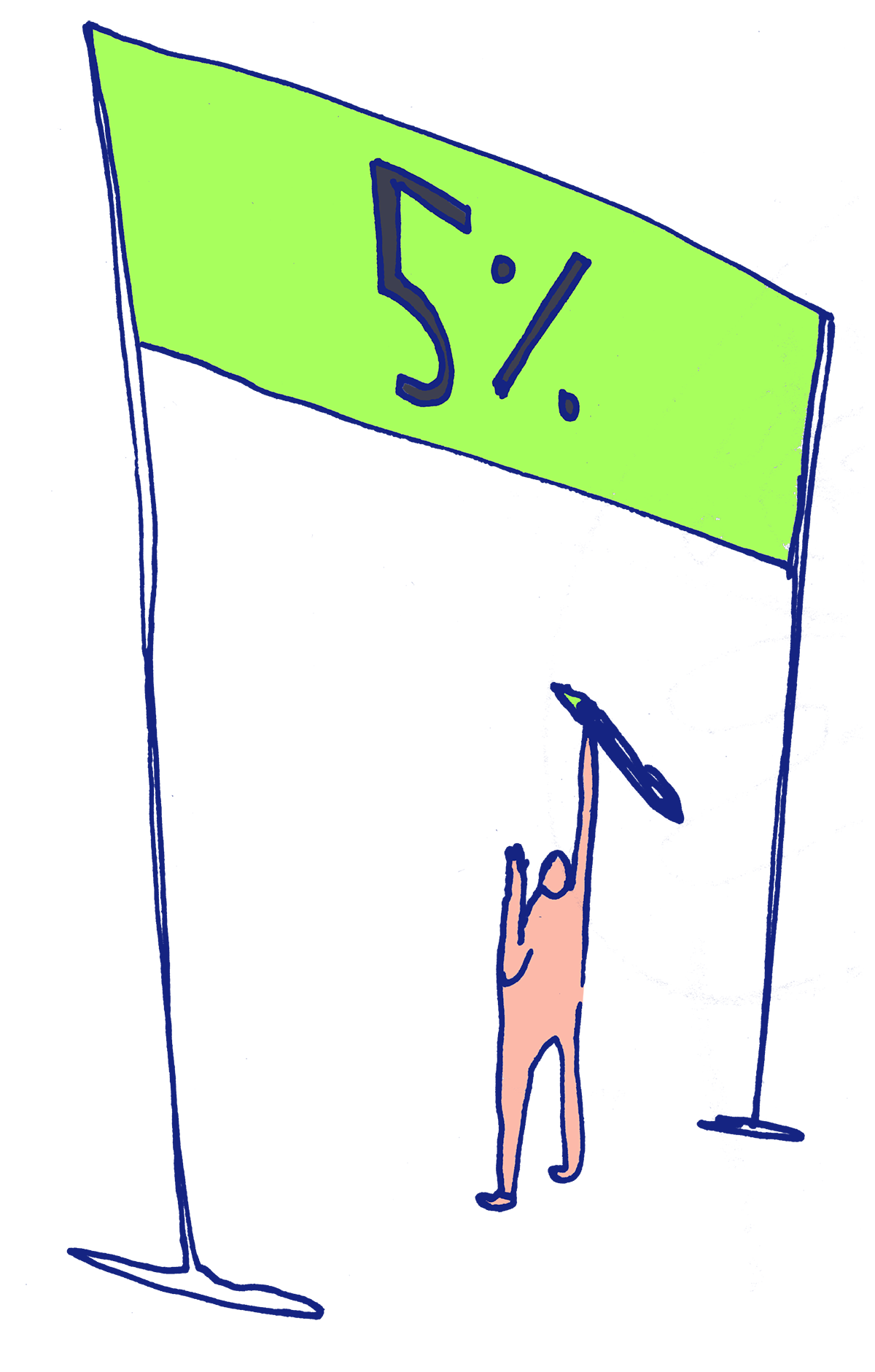Frau Küpper, gibt es die typische Nichtwählerin oder den typischen Nichtwähler?
Nein. Aber es gibt bestimmte Muster: Da sind die, die sporadisch nicht wählen gehen, und die, die dauerhaft nicht wählen. Sehr allgemein formuliert: Je unzufriedener die Leute sind, desto dauerhafter entscheiden sie sich, nicht wählen zu gehen.
Wie wird dauerhaftes Nichtwählen begründet?
Manche haben schlicht kein Interesse an Politik, sind sich aber gleichzeitig nicht bewusst, was alles politisch ist. Wenn es keine Vorbilder gibt, wenn Eltern und Freunde nicht wählen gehen, sprich: wenn es nicht die soziale Norm um einen herum ist, wählen zu gehen, dann ist es auch unwahrscheinlicher, dass diese Menschen selbst wählen gehen. Andere Gründe sind: das Gefühl von politischer Machtlosigkeit oder der bewusste politische Protest – also der Wahlboykott als Denkzettel. Es bleibt abzuwarten, ob sich hier auch neue Protestmilieus herausbilden, die sich im „Widerstand gegen das System“ sehen und die deshalb auch nicht wählen gehen. Kurz: Nicht wählen zu gehen kann sowohl mit Politikferne zu tun haben als auch eine sehr bewusste politische Entscheidung sein.
Sebastian, 31 Jahre, IT-Experte:
„Ich bin der Auffassung, dass unser demokratischer Prozess nicht geeignet ist, die besten Menschen als Volksvertreter auszuwählen – moralisch und auch hinsichtlich ihrer Kompetenz. Das ist ein strukturelles Problem des politischen Systems. Statt um gute politische Willensbildung und Gestaltung geht es vor allem um Machtspielchen und Absprachen in Hinterzimmern.
Als die Demokratie erfunden wurde, war noch nicht absehbar, dass einmal über Themen wie Atomkraft entschieden werden muss. Das ist alles so hochdifferenziert und vielschichtig, dass es noch nicht mal Experten komplett überblicken. Wie sollen dann Bürger und Politiker sinnvoll über so ein Thema entscheiden? So ist das meiner Auffassung nach bei sehr vielen politischen Fragen.
Vielleicht wird es in Zukunft mal eine technische Lösung geben, mit der man datengetrieben herausfindet, welche politischen Entscheidungen sich die Menschen wirklich wünschen. Auf diese Weise könnte es möglicherweise gelingen, die wahren Präferenzen der Leute und ihre Wertehierarchie in Politik umzusetzen.“ (og)
Sticht eine bestimmte Gruppe von Nichtwählerinnen und Nichtwählern heraus?
Überproportional häufig nicht wählen gehen Menschen aus prekären sozialen Milieus, jene mit niedriger Schulbildung, geringerem Einkommen und Berufsstatus. Wählen zu gehen ist in Deutschland sehr bildungsabhängig. Themen wie Wahlen und politische Beteiligung werden häufig in der Oberstufe der Schulen besprochen, manchmal auch in Schülerparlamenten eingeübt. Mit 18 zum ersten Mal wählen zu gehen kann dann geradezu ein Event sein: Man ist vielleicht ein bisschen aufgeregt, stolz und hat das Gefühl, nun endlich erwachsen zu sein. Wer aber mit 16 die Schule verlässt, bekommt davon oft nichts mit. Und wird sich vielleicht später nicht mehr damit auseinandersetzen.
Gibt es einen Trend bei jungen Erwachsenen, was die Wahlbeteiligung angeht?
Die Wahlbeteiligung ist insgesamt in den letzten Jahrzehnten gesunken, und Jüngere gehen generell seltener zur Wahl als Ältere. Bei der Bundestagswahl 2017 sind dann aber wieder mehr Jüngere wählen gegangen als zuvor. Die Wahlbeteiligung der unter 30-Jährigen lag bei fast 70 Prozent, insgesamt liegt sie bei 76 Prozent. Wie in fast allen Altersgruppen unter 60 Jahren gehen auch bei den Jüngeren Frauen etwas häufiger zur Wahl als Männer. Auch bei der Europawahl 2019 war die Wahlbeteiligung unter Jungen so hoch wie nie, vielleicht auch, weil Umweltschutz und der Brexit präsent waren – beides Themen, die besonders junge Menschen und ihre Zukunft betreffen. Ein Grundproblem bleibt: Demografisch gibt es doppelt so viele Wahlberechtigte ab 60 wie unter 30 Jahren. Das heißt, die Jüngeren haben tatsächlich wenig Einfluss aufs Wahlergebnis. Zumindest solange es die vielen Älteren noch gibt.
Ivan, 34 Jahre, Unternehmensberater in Frankfurt:
„Früher bin ich wählen gegangen, zuletzt vor fünf Jahren, das war bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die Schnittmenge zwischen mir und den sich zur Wahl stellenden Parteien ist aber immer kleiner geworden. Heute kann ich keine Partei mehr mit gutem Gewissen unterstützen. Das kleinste Übel wählen, um ein größeres zu verhindern? Das will ich auch nicht.
Viele meiner Ansichten sind links geprägt, weshalb der Großteil der Parteien für mich grundsätzlich unwählbar erscheint. Kleinstparteien will ich auch nicht wählen, da sich das für mich wegen der Fünf-Prozent-Hürde wie eine verschenkte Stimme anfühlt. Und selbst eine gründen? Da erscheint mir der Aufwand dann doch zu groß.
Um trotzdem politisch teilhaben zu können, gehe ich auf Demos. Eine Zeit lang habe ich auch ehrenamtlich in einem Verein gearbeitet, der in Schulen geht und politisch aufklärt. Ich fände es besser, wenn die Demokratie in Deutschland direkter wäre und es mehr Volksentscheide gäbe – so wie in der Schweiz. Dann würde ich auch wieder wählen gehen.“ (sg)
Unsere Interviewpartnerinnen und -partner brachten durchweg politische Gründe fürs Nichtwählen vor. Sebastian etwa argumentiert, Themen wie Atomkraft seien so komplex, dass die Bürgerinnen und Bürger sowieso nur auf Basis von Halbwissen entscheiden würden.
Er hat recht: Die Themen sind in der Tat sehr komplex. Aber deswegen gibt es ja unter anderem die repräsentative Demokratie: damit sich gewählte Politikerinnen und Politiker hauptberuflich verschiedene Perspektiven anhören können. Man kann darüber streiten, wer eine Lobby hat und wer nicht. Aber ich würde Sebastian fragen: Wie stellt er sich das politische System sonst vor? Wir leben nun mal in einer hochkomplexen Gesellschaft und müssen die ordnen. Eben weil die Dinge kompliziert liegen, haben wir nicht eine Meinung zu allem, die man einfach abfragen kann. Wir müssen uns unsere Meinungen erst bilden. Im politischen Raum geht es ja darum, sich zunächst fundiert eine Position zu erarbeiten und dann eine Entscheidung zu treffen.
Interviewpartner Ivan würde wählen gehen, wenn es mehr direkte Demokratie gäbe.
Die Forderung an sich ist legitim und nicht per se populistisch. Man muss sich aber trotzdem genau anschauen, aus welcher Richtung sie kommt. Denn gefordert wird das auch von rechtspopulistischer Seite. „Direkte Demokratie“ passt nämlich zur Grundlogik, dass die „Eliten“ angeblich alle korrupt sind und „das Volk“ dagegen moralisch rein und dass ein einziger Führer den vermeintlichen Volkswillen erfühlt und umsetzt, ohne Vermittlung durch Zwischeninstanzen wie öffentlich-rechtliche Medien und gewählte Repräsentanz.
Moritz, 19 Jahre, Student aus München/Regensburg:
„Ich darf im September zum ersten Mal wählen, will aber nicht. Unsere repräsentative Demokratie finde ich gut und richtig. Und stünde eine rechte Partei vor der Mehrheit, würde ich doch noch wählen. Beides ändert aber nichts daran, dass ich mich durch keine der zur Wahl stehenden Parteien vertreten fühle.
Mir ist ökonomische Gleichheit besonders wichtig. Große Teile der Parteien verlieren sich jedoch zunehmend in Identitätspolitik: Viele sehen die Gesellschaft nur noch als Wettstreit der Kulturen und Ethnien, in dem die kämpferische Veränderung der Ungleichheit gar keine Option ist.
Mir fehlen bei allen großen Parteien eine Haltung zur sozialen Frage und Konzepte gegen wachsende Ungleichheit und ihre Ursachen. Die Parteien stehen gerade allenfalls für verschiedene Facetten des Neoliberalismus – eine Ideologie, die ich mit meiner Stimme nicht legitimieren will. Wählen würde ich eine Partei, die sich nicht in Symptompolitik und Reförmchen verliert; nicht versucht, im bestehenden System gerecht zu handeln, sondern ein gerechtes System schaffen will. Dass so eine Bewegung erfolgreich sein kann, sieht man zum Beispiel in Frankreich, wo die Klassenfrage gesellschaftlich viel mehr verankert ist.“ (ph)
Die Schweiz als Musterland der direkten Demokratie hatte bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2019 eine Wahlbeteiligung von 45 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland gab es bei der letzten Bundestagswahl eine Wahlbeteiligung von 76 Prozent. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
Ein Grund dafür ist, dass die Menschen in der Schweiz sehr oft an die Urne gerufen werden, sowohl auf Bundesebene wie bei Entscheidungen in den Kantonen und Gemeinden. Sie mögen dann denken: In Dingen, die mir wichtig sind, habe ich schon direkt entschieden. Eine Herausforderung bei Volksentscheiden ist, dass hier hochkomplexe Themen auf ein einfaches „Ja oder Nein“ heruntergebrochen werden. Man muss sich also vorher gut informieren, um nicht einfach nur eine Bauchmeinung zu haben. Wir können sehen, dass auch die Schweizerische Volkspartei, SVP, bei Volksentscheiden der populistischen Logik folgt und Volksentscheide nicht unbedingt in erster Linie unterstützt, um zu einer guten Sachentscheidung zu gelangen, sondern auch um Stimmung zu machen. Bei der sogenannten „Ausschaffungsinitiative“, die in 2010 von der SVP zur Abstimmung gebracht und mit einer Mehrheit von 52,9 Prozent angenommen wurde, ging es um die Forderung, straffällig gewordene Ausländer sofort abzuschieben, auch wenn im Zielland Folter oder Todesstrafe drohen. Nach Ansicht der Gegenseite verstößt eine solche Forderung gegen das Völkerrecht, EU-Recht und Grundrechte. Nach jahrelangen Diskussionen im Parlament wurde schließlich eine Härtefallklausel ergänzt, um nicht gegen das Verfassungsprinzip der Verhältnismäßigkeit zu verstoßen.
Teresa L., 27 Jahre, studiert soziale Arbeit
„Als ich begann, darüber nachzudenken, was es bedeutet, meine Stimme einer Partei zu geben, wurde mir klar: Damit legitimiere ich unser politisches System, das ich eigentlich ablehne, weil ich nicht möchte, dass wir kapitalistisch wirtschaften. Keine Partei kann mir zur Wahl stellen: Wir schauen mal, ob uns da was Besseres einfällt. Das wäre verfassungsfeindlich. Der Autor Marc-Uwe-Kling beschreibt das mit dem von ihm so genannten Tütensuppen-Totalitarismus: Ich kann wählen zwischen der Tütensuppe von Knorr und der von Nestlé. Nur was, wenn ich gar keinen Bock auf Tütensuppe habe?
Wir sollten in Diskussionen den Kapitalismus als Problemfaktor begreifen. Dass etwas schiefgeht, ist ja Konsens. Zumindest kenne ich keine Person, die das nicht so sieht, wenn Kinder verhungern. Manche versuchen, Probleme innerhalb des Systems zu lösen: wenn doch alle Müll trennen würden oder weniger Fleisch essen. Aber es gibt kein richtiges Leben im falschen. Mit so einer Meinung wird man schnell in die linksextreme Ecke gestellt. Das ist schade, ich will auch nicht im Kommunismus oder Sozialismus leben. Aber ich weigere mich anzunehmen, dass uns nichts Besseres einfällt als der Kapitalismus.“ (tm)
Warum ziehen es einige vor, gar nicht zu wählen, statt eine ungültige Stimme abzugeben? Das wäre doch auch eine Form des Protests gegen das Angebot der politischen Parteien.
Das wäre ein deutlich höherer Aufwand. Und etliche wollen nicht nur die Wahl, sondern den ganzen Prozess boykottieren. Letztendlich gibt es zudem immer nur wenige ungültige Stimmen, sodass der Protest verhallt und keine Diskussion darüber stattfindet. Die findet eher über die Nichtwähler:innen statt.
Wie überzeugt man diese Menschen vom Wählen?
Das Wählengehen an sich ist nicht automatisch demokratisch. So können Bürger:innen zum Beispiel auf Bundes- und Landesebene zum Teil die verfassungsfeindliche NPD wählen. Frühere Nichtwähler:innen entscheiden sich vergleichsweise oft für eine rechtspopulistische Partei wie die AfD, wie Analysen von Wählerwanderungen etwa von infratest dimap belegen. Bevölkerungsbefragungen wie die von uns durchgeführte Mitte-Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert Stiftung liefern zudem Hinweise darauf, dass Nichtwähler:innen im Durchschnitt fremdenfeindlicher eingestellt sind als die Wähler:innen der etablierten Parteien und es der AfD in den letzten Jahren gelungen ist, gerade die fremdenfeindlich Eingestellten unter den Nichtwähler:innen für sich zu gewinnen. Dann kann Wählen bei manchen auch Ausdruck von gerichtetem Protest sein: Ich bin mit der liberalen Demokratie und der offenen Gesellschaft nicht einverstanden.
Lisa, 24 Jahre, Assistentin für behinderte Menschen
„Ich habe kaum Vertrauen in die Politik. Zum einen finde ich, dass generell zu wenig Transparenz herrscht. Es wird immer viel versprochen, das letztendlich nie umgesetzt wird. Ich würde mir mehr direkte Partizipationsmöglichkeiten wünschen, sodass Bürger:innen unabhängig von den Wahlen und Parteien aktiv die Politik mitgestalten können.
Zum anderen haben Skandale wie die Ibiza-Affäre mein Vertrauen stark geschädigt – da konnte man als Wähler:in mal hinter die Fassade schauen und sehen, was wirklich los ist in der Politik.
Ich glaube auch nicht, dass echte politische Partizipation etwas mit Parteipolitik zu tun haben muss. Wir nehmen alle allein deswegen schon Einfluss, weil wir unterschiedliche Haltungen und Meinungen vertreten. Im Endeffekt kann man die Dinge am besten verändern, wenn man selbst mit anpackt.
Ich arbeite als persönliche Assistentin für Menschen mit Behinderungen und helfe ihnen, selbstbestimmt zu leben. Damit leiste ich einen Beitrag für eine inklusivere Gesellschaft. Für mich ist das auch ein politisches Statement.“ (nv)
Anders formuliert: Wie schaffen wir es, dass mehr junge Menschen ihre Stimme für eine demokratisch gesinnte Partei abgeben?
Wichtig wäre es, potenzielle Erstwähler:innen anzusprechen. Und zwar nicht nur an den Gymnasien, sondern überall, etwa auch an den berufsbildenden Schulen. Es braucht zudem Vertrauenspersonen und Vorbilder in den unterschiedlichen Milieus. Und wir müssen mehr politische Kultur lernen und einüben: Was ist eine demokratische Auseinandersetzung? Wie findet man zu einem Kompromiss, und warum kann das so langwierig sein? Die Demokratie ist so viel mehr als nur wählen zu gehen. Was helfen würde: Wenn die Stimmabgabe zum Trend wird, wie zuletzt bei der Europawahl: Man geht zur Wahl, weil es ein hart erkämpftes Recht ist und große Möglichkeiten als Bürger:in bietet, wofür viele auf der Welt dankbar wären.
Beate Küpper ist Professorin für soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Über das Thema dieses Interviews hat sie viel geforscht und 2017 die Studie „Das Denken der Nichtwählerinnen und Nichtwähler: Einstellungsmuster und politische Präferenzen“ veröffentlicht.
Illustration: Frank Höhne