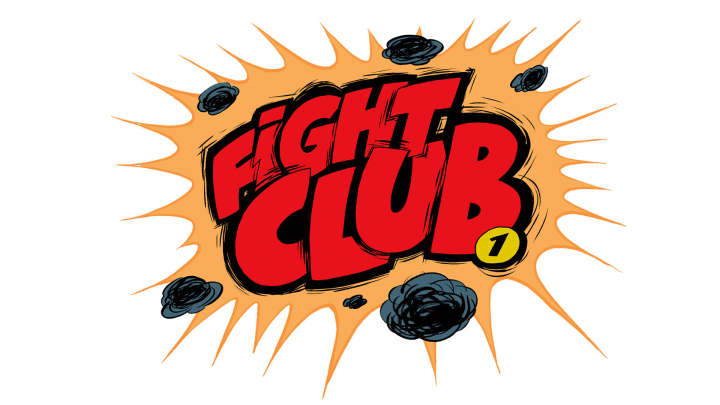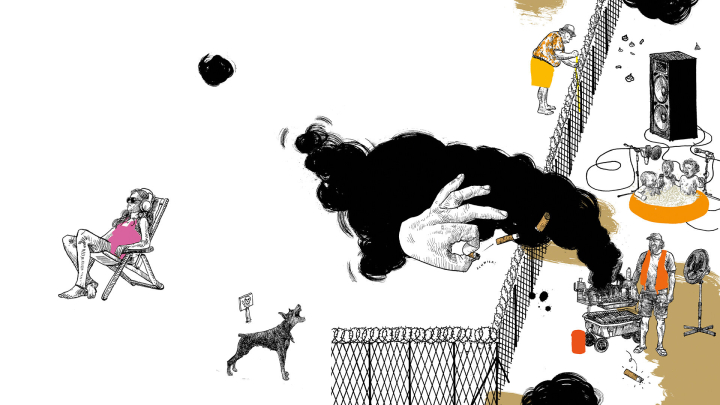Tage des Zorns
Unsere Autorin ist konfliktscheu bis zur Selbstverleugnung. Ein Seminar soll Abhilfe schaffen

Drei Anläufe brauche ich, bevor der Satz endlich sitzt: „Für mich bedeutet das, dass es dir scheißegal ist, ob ich mich in meiner eigenen Wohnung ekle.“ Hingeschrieben klingt das einfach, ausgesprochen verlangt es mir einiges ab. Sonntagnachmittag in einer Berliner Volkshochschule. Die Handvoll Erwachsener, die hier zusammensitzt, vereint eines: Sie wollen lernen, mit Konflikten umzugehen. Es soll Menschen geben, die Streit mögen. So gern sogar, dass sie Berufe wie Politikerin oder Talkshow-Gastgeber ergreifen und offene Auseinandersetzungen zu ihrem Alltag machen.
Mich macht Streit fertig. Wenn im Deutschlandradio die Moderatorin einen Politiker wegen seiner Ansichten zur Migration grillt, muss ich abschalten. Wenn andere laut werden, bekomme ich schwere Schweißausbrüche. Es ist mir körperlich unangenehm, einer Auseinandersetzung beiwohnen zu müssen, erst recht, sie selbst zu führen.
Glaubt man allen Ratgebern, die ich dazu gelesen habe, steht dahinter die Angst vor Ablehnung. Ein anderer Grund liegt ganz offenbar in meiner Familie. In anderen Haushalten mag am Abendbrottisch diskutiert worden sein, bei uns gab es so gut wie nie offene Auseinandersetzungen. Als meine Eltern meinem Bruder und mir mitteilten, dass sie sich scheiden lassen würden, fielen wir aus allen Wolken. Nichts – kein Gebrüll, keine knallenden Türen, kein verächtlicher Blick – hatte darauf hingedeutet, dass sie sich nicht mehr verstanden. Ich habe schlicht nicht gelernt, wie Streiten geht.
Konflikte verschwinden nicht, wenn man sie wegdrückt
Leider verschwinden Unzufriedenheit und verletzte Gefühle nicht, wenn man es vermeidet, sie anzusprechen. Sie suchen sich nur einen anderen Weg und kommen dann als passiv-aggressives Gepampe heraus oder bleiben als nagender Groll in der Körpermitte sitzen. Beides kenne ich gut, deswegen sitze ich an diesem Wochenende in der Volkshochschule, um zum Vorzugspreis von 55,80 Euro in Theorie und Rollenspielen das Streiten zu lernen.
Wir sind acht Erwachsene zwischen Anfang 30 und Anfang 50. Zwei meiner Mitstreiter sind dabei, weil ihnen ihre Konfliktflucht schon auf den Magen schlägt. Eine Teilnehmerin bezeichnet sich als Vulkan, die Gefühle brodeln so lange in ihr, bis sie irgendwann unkontrolliert ausbrechen.
Der erste Seminartag gehört dem Grundlagenwissen: Was ist eigentlich ein Konflikt? Eine subjektiv empfundene Spannungssituation. Was gilt es dabei nie zu vergessen? Es gibt keine objektive Wahrheit, nur Situationen und unseren individuell gefärbten Blick auf sie. Welcher Grundmechanismus herrscht kulturübergreifend? Konflikte funktionieren zirkulär, heißt: Jede Seite betrachtet sich selbst als diejenige, die lediglich auf das Verhalten der anderen reagiert, woraufhin diese dann wieder... und so weiter.
Unser Umgang mit Konflikten, erklärt die Seminarleiterin, sei größtenteils familiär bedingt, über den Rest entschieden unser Charakter und das kulturelle Umfeld. Die gute Nachricht: Weil ein Großteil unseres Verhaltens in Konflikten erlernt sei, lasse es sich auch verändern. Die schlechte Nachricht: Es sei gut, Dinge, die man als störend oder verletzend empfindet, frühzeitig anzusprechen und zu klären. Das ist der Moment, in dem ich mich melde und frage: Was, wenn ich es 15 Jahre lang verpasst habe, einen Konflikt zu thematisieren?
Es ist nämlich so: Ich wohne mit meiner besten Freundin zusammen – und finde meist ein ungeputztes Bad vor, wenn ich von einer Reise zurückkehre. Das geht seit anderthalb Jahrzehnten so, und genauso lange ärgere ich mich darüber. Aber hasenfüßig, wie ich bin, habe ich das Thema nie angesprochen. Weil ich Haare auf den Fliesen und Wollmäuse in den Ecken wirklich nicht mag, endet es immer gleich: Ich grummle nach meiner Heimkehr still in mich hinein und schicke den Staubsaugerroboter durchs Bad.
Ich- statt Du-Botschaften! Aber wie fang ich an?
Durch den allgemeinen Achtsamkeitshype und das gewachsene Bewusstsein für mentale Gesundheit sind viele mit Gewaltfreier Kommunikation (GfK) vertraut. Manche sprechen fließend GfK. Das Konzept hat der US-amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg ab den 1960er-Jahren entwickelt. Es basiert auf vier Schritten: Erst formuliert man – möglichst wertfrei – eine Beobachtung, dann das Gefühl, das sich daraufhin bei einem selbst einstellt. Als Nächstes äußert man das eigene Bedürfnis und schließlich eine Bitte. GfK gilt als Goldstandard der Konfliktlösung, sei es in Paarbeziehungen, der Psychotherapie oder der internationalen Diplomatie. Auch mir wurde mehr als einmal geraten, Generalisierungen und Anklagen zu vermeiden und Ich- statt Du-Botschaften zu formulieren. Nur hilft mir das Konzept leider kein Stück dabei, meine Furcht vor Auseinandersetzungen zu überwinden.
Was dagegen hilft, mein Problem anzugehen: mir die Gründe zu vergegenwärtigen, warum sich eine Auseinandersetzung lohnt. Die Seminarleiterin lässt uns aufschreiben, wofür Konflikte gut sein können:
Sie sind Mittel der Kommunikation.
Sie dienen einem Perspektivwechsel.
Sie ermöglichen Veränderungen.
Sie vertiefen Beziehungen.
Sie stellen die Demokratie sicher.
Am Ende ist die Liste länger, als ich gedacht hätte. Mich überzeugt vor allem das Argument, das Konfliktlösung wie ein Muskel funktioniert: Je öfter man es tut, desto leichter wird es. Auch die sehr naheliegende Überlegung, dass Konflikte helfen können, eigene Interessen durchzusetzen, kommt mir angesichts meines Badproblems hilfreich vor.
Ich bin mir wegen meiner Konfliktscheue immer ein bisschen minderbemittelt vorgekommen. Aber an diesem Wochenende lerne ich: Es gibt keinen besseren oder schlechteren Konfliktstil. Ob man die Konfrontation vermeidet, in einem Konflikt nachgibt, sich durchsetzt oder einen Kompromiss findet: Alles hat Vorteile und Nachteile. „Das Ziel entscheidet über den Stil“, sagt die Seminarleiterin. Wenn ich in Sachen Dreckbad bislang die Vermeidung statt des offenen Streits gewählt habe, dann war das schon eine Konfliktstrategie – und für mich der Weg des geringsten Widerstandes. Der Satz der Seminarleiterin klingt für mich befreiend.
Streiten mit Fahrplan
Ganz ohne GfK geht es auch in unserem Seminar nicht. Aber weil sich die Leiterin vor lauter behutsamen Ich-Botschaften und verbalem Appeasement förmlich danach sehnt, mal wieder jemanden zusammenzustauchen, belässt sie es bei den Grundlagen. Und erklärt uns abschließend zwei Konflikttechniken, die oft helfen sollen, mit der Sprache rauszurücken: eine zur ergebnisoffenen Verhandlung („Wie siehst du das, und welche Lösung siehst du?“), und eine, die Konflikte quasiautoritär in eine gewünschte Lösung übersetzt („Das ist es, was ich will und warum“).
Die zweite hilft mir tatsächlich: In der anschließenden Übung formuliere ich die Sätze, die mir lange so schwergefallen sind: „Ich will, dass du in Zukunft putzt, bevor ich nach Hause komme. Denn für mich bedeutet das schmutzige Bad, dass es dir scheißegal ist, ob ich mich in meiner eigenen Wohnung ekle.“ Klingt wirklich nicht gewaltfrei. Egal, sagt die Seminarleiterin. Wichtiger sei erst mal, klar zu formulieren. Im späteren Streitgespräch könne ich das immer noch netter ausdrücken.
Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Zumindest glaube ich aber, jetzt so etwas wie einen Fahrplan zu haben. Ich streite für (nicht etwa über) etwas. Es geht mir weniger um dreckige Fliesen als um die fehlende Anerkennung für ein Bedürfnis (nicht auf Staubmäuse und Teppiche aus Haaren zu treten, die nicht meine sind). Und wenn ich mein Anliegen sachlich und nachvollziehbar formuliere, droht mir vermutlich auch keine Ablehnung. Und noch eins habe ich gelernt: ohne konkreten Anlass kein Konfliktgespräch. Die Wörter „immer“, „jedes Mal“ oder „seit 15 Jahren“ haben wohl noch nie einen gelungenen Streit eingeleitet. Was das Bad angeht, warte ich also wohl lieber auf die nächste Reise. Oder ich lasse diesen Text offen auf dem Küchentisch rumliegen.
Illustration: Sebastian Haslauer
Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 91 „Streiten“ erschienen. Das ganze Heft findet ihr hier.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.