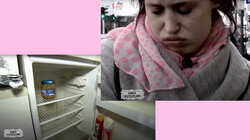Es ist eine leise Katastrophe, die trotz guter Datenlage fast unsichtbar ist. Die Lebenszeit, die ein Mensch in Deutschland zur Verfügung hat, ist abhängig von der sozialen Klasse: Menschen, die körperlich arbeiten, sterben in Deutschland durchschnittlich über vier Jahre früher als Beamte und Beamtinnen. Kassenpatienten erwartet ein deutlich kürzeres Leben als Privatversicherte, und das gesundheitliche Wohl könnte zwischen über und unterdurchschnittlich verdienenden Menschen kaum unterschiedlicher sein. Arme Männer in Deutschland haben eine über 14 Jahre kürzere beschwerdefreie Lebenserwartung als jene, die das Anderthalbfache des Durchschnitts verdienen. Im Jahr 2019 galt ein Mensch als arm, der nicht mehr als 1.074 Euro im Monat zum Leben hatte.
Die Coronapandemie hat diese existenzielle Benachteiligung in zahlreichen Ländern sichtbar gemacht, denn das Virus trifft nicht alle sozialen Klassen gleichermaßen. Ärmere und sozial benachteiligte Menschen tragen ein deutlich höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe und hatten in Deutschland im vergangenen Winter eine bis zu 70-Prozent höhere Sterblichkeitsrate bei einer Covid-19-Infektion. Besonders in den USA traf das Virus die ärmere – und oft nichtweiße – Bevölkerung deutlich stärker. Diese Menschen kamen fast dreimal so oft ins Krankenhaus, die Todesrate war doppelt so hoch wie beim Rest der Bevölkerung. „Wir müssen Sterben und Krankheit als etwas anerkennen, das in weiten Teilen gesellschaftlich verursacht ist, das uns nicht einfach zustößt“, sagt die Leitung des Zentrums für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der TU Berlin, Sabine Hark.
Statistisch gesehen verlängert ein Abizeugnis das Leben schon um mehrere Jahre
Der Zusammenhang zwischen Klassenzugehörigkeit und Gesundheit ist in einer Vielzahl bedeutender Studien nachgewiesen, die zu eindeutigen Ergebnissen kommen: So verlängert ein Abizeugnis das Leben gleich um mehrere Jahre. Wer in Stadtteilen mit Sozialbauten wohnt, lebt im Schnitt zehn Jahre kürzer als jemand aus einem wohlhabenden Bezirk. Oft sind ärmere Menschen im Beruf – von der Fabrikarbeit bis zum Bergbau – erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt und wohnen in Ballungsgebieten mit deutlich stärkerer Luftverschmutzung und Lärmbelastung. Beides sind Faktoren, die die Gesundheit nachweislich negativ beeinflussen.
„Es ist eine Ungleichheit, die, in gewisser Weise unsichtbar, fast ein gesellschaftliches Tabu ist. Wir haben nicht einmal einen richtigen Begriff dafür, während die Bezeichnung vital inequality im Englischen zumindest sachlich treffender ist“, sagt Silke van Dyk, Soziologin mit Schwerpunkt Demografie und Ungleichheitsforschung, und weist darauf hin, dass die Betroffenen oft selbst verantwortlich gemacht oder sogar stigmatisiert würden. So werde die geringere Lebenserwartung in öffentlichen Debatten sehr stark auf gesundheitsschädigendes Verhalten ärmerer Personen zurückgeführt. Das Klischee von der kettenrauchenden, Chips essenden Couch Potato im Plattenbau ist weit verbreitet.
Dabei ist ungesundes Essverhalten nicht das Produkt mangelnder Selbstkontrolle. Darum greife es auch zu kurz, dieses Problem mit Aufklärungskampagnen und Wissensvermittlung über gesundes Verhalten beheben zu wollen, meint der Bildungsforscher Werner Friedrichs von der Universität Bamberg. „Wir müssen von der Oberfläche der Sozialstatistiken in die ganz konkrete Lebenswelt der Menschen eintauchen. Rauchern fehlt es ja nicht an Wissen über die Giftstoffe in einer Zigarette.“
Irreführend ist die Betonung eines vermeintlich ungesunden Lebensstils auch deswegen, weil es entscheidende Faktoren, wie gesundheitsgefährdende Wohn- und Arbeitsorte, höhere Unfallrisiken, Ungleichbehandlung im Gesundheitssystem, Existenzängste oder Diskriminierungserfahrungen, in den Hintergrund drängt.
Darum setzt sich in der Forschung zunehmend die Erkenntnis durch, dass man für eine gerechter verteilte Lebenserwartung nicht am individuellen Verhalten, sondern an den Verhältnissen selbst ansetzen müsste. Das betrifft auch den Zugang zu medizinischer Versorgung. Während man früher davon ausging, dass medizinischtechnologische Fortschritte allen zugutekommen, gilt es mittlerweile als bewiesen, dass gut vernetzte und besser gebildete Menschen sich stets früher und leichter Zugang zu neuen Gesundheitsleistungen verschaffen können. Ein weiteres Beispiel für handfeste Unterschiede zwischen den sozialen Klassen ist das Rentensystem. Für alle Menschen gilt ein gemeinsames Eintrittsalter, obwohl viele Berufe körperlich so anstrengend sind, dass eine deutlich kürzere Lebenserwartung belegt ist. Silke van Dyk nennt das eine „substanzielle Umverteilung von unten nach oben. Früh Sterbende finanzieren die Renten der Besserverdienenden“. In Studien wird darum die Möglichkeit von Ausnahmen diskutiert. Bereits heute dürfen Menschen, die langjährig im Bergbau beschäftigt waren, ihre Rente in Deutschland schon mit 60 Jahren antreten.
Illustration: Wolfgang Wiler