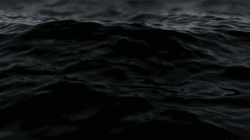Es gibt einen Ort auf unserem Planeten, der sich vor Milliarden von Jahren in unseren Körpern festgeschrieben hat, von dem bis heute unser Überleben abhängt und den wir dennoch schlechter kennen als manchen Nachbarplaneten: das Meer.
Wenn wir an seinen Ufern stehen, dem unaufhaltsamen Rhythmus seiner Wellen lauschen und uns im Angesicht der sich bis zum Horizont erstreckenden Wassermassen winzig fühlen, liegt es wie eine offene Frage vor uns: Was ist das Meer? Nüchtern heißt die Antwort: Eine 362 Millionen Quadratkilometer große Fläche, durchschnittlich fast 4.000 Meter tief, gefüllt mit etwa 1,35 Milliarden Kubikkilometern Salzwasser, verteilt auf die sieben Weltmeere Nord- und Südatlantik, den Nord- und Südpazifik, den Indischen, Antarktischen und Arktischen Ozean und die Nebenmeere.
Diese Wassermassen bedecken rund 70 Prozent der Erdoberfläche und sind der größte belebte Raum des Planeten. Millionen Arten werden darin vermutet, von beinah unsichtbaren Mikroben, die 11.000 Meter unter der Wasseroberfläche von dem leben, was zu ihnen hinabschwebt, über farbenfrohe Schwämme und Korallenriffe bis hin zu riesenhaften Walen, die nomadisch die Ozeane durchstreifen. Wie viele Tier- und Pflanzenarten jedoch genau in der lichtlosen Tiefsee leben, weiß niemand zu sagen.
Würde man sich reines Blutplasma auf die Zunge legen, schmeckte es wohl nach Meer
„In der Tiefsee herrscht ein anderes Tempo als an der Erdoberfläche, viele Lebewesen dort werden sehr alt und wachsen nur langsam“, erzählt die Meeresbiologin Antje Boetius, die bis auf 3.450 Meter hinabgetaucht ist. Sie besucht Orte, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. „In der Tiefsee leben einzigartige Lebensformen, von denen viele wie Fantasiewesen aussehen“, in der absoluten Dunkelheit begegneten ihr leuchtende Meeresbewohner, die ihr eigenes Licht produzieren, die durch Strömung, Töne oder chemische Signale kommunizieren. Boetius’ Beschreibungen klingen wie aus einer anderen Welt – und stammen doch nur aus einigen Hundert Metern Tiefe.
So fremd den meisten Menschen die von Kälte, Sauerstoffmangel, Druck und Finsternis geprägte Meereswelt ist, es gibt auch eine weitreichende Verbundenheit. Wer dem wiegenden Rhythmus des Wellengangs zuhört, seinem Gluckern, Schlagen und Rauschen, fühlt sich nicht umsonst an den eigenen Herzschlag erinnert: Nicht nur besteht der Mensch überwiegend aus Wasser, auch das Mengenverhältnis von Natrium-, Chlorid-, Kalium- und Kalziumionen ist im Meerwasser und im menschlichen Blutplasma sehr ähnlich. Würde man sich reines Blutplasma auf die Zunge legen, schmeckte es wohl nach Meer – eine Spur zu den Anfängen des Lebens auf der Erde, als Einzeller vor 3,5 Milliarden Jahren im Meer schwebten und sich dabei dem Salzwasser der Ozeane anpassten.
Die Meere helfen uns beim Atmen und sie regulieren das Klima
Und nicht nur unser Körper, auch unsere gesamte Umwelt ist mit den Meeren unmittelbar verbunden: In den Ozeanen passieren Stoffkreisläufe, die für uns und den Rest der Welt überlebenswichtig sind. So ist alles Wasser auf der Erde miteinander verbunden, wird aus den Meeren, aus Seen, Flüssen und kleinsten Pfützen durch Verdunstung, Wind, Niederschlag und Versickerung immer wieder neu auf der Erde verteilt. Die Meere helfen uns beim Atmen, denn etwa die Hälfte des Sauerstoffs in der Atmosphäre wird von Phytoplankton produziert. Und sie regulieren das Klima: 34.000 Gigatonnen Kohlenstoff wurden zwischen 1994 und 2007 in den Weltmeeren gebunden, die Ozeane „schluckten“ damit etwa ein Drittel der menschengemachten CO₂-Emissionen und bremsten die Erderwärmung ab.
Unser Leben ist nicht ohne das Meer und das Meer nicht ohne seine Tiefe zu begreifen. Wir, die wir nur an seinen Rändern planschen, vom Liegestuhl auf seine Oberfläche starren und auf seinen Wellen reiten, können seine Abgründe und deren Bedeutung nur erahnen. Der Schriftsteller Albert Camus beschrieb dieses Gefühl in seinem Tagebuch so: „Das Festland ist letzten Endes nur eine sehr dünne Platte auf dem Meer. Eines Tages wird der Ozean herrschen.“