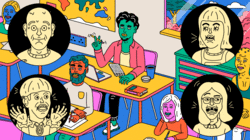Nach 40 Minuten und einigen Downward-Facing-Dogs liege ich mit geschlossenen Augen auf dem Boden. Die Yogalehrerin spricht über Zusammenhalt und das Großartige am gemeinsamen Sporteln. Ich höre, wie eine Teilnehmerin hinter mir flüstert: „Ich bin so gut runtergekommen, ich habe fast geweint.“ Als ich die Augen aufmache, realisiere ich, wie neu das alles hier für mich ist. Nicht das Yoga, das mache ich schon eine Weile. Es sind die knapp 30 anderen Teilnehmer*innen, die wie ich fast alle People of Color sind.
Heute nehme ich zum ersten Mal am Black Canary Outdoor Club teil, einem Sportangebot in Berlin für Schwarze FLINTA – Frauen, Lesben, intersexuelle, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen. Gegründet wurde Black Canary von Tsellot Melesse, einer 27-Jährigen, die outdoorbegeistert ist und es satthatte, die einzige Schwarze Frau beim Campen und Wandern zu sein. „Ich möchte die Outdoorszene für unsere Leute öffnen, weil ich weiß, wie gut das für die mentale Gesundheit ist“, erklärt Tsellot mir später. Der erste Ausflug fand im April 2021 statt. Seitdem trifft sich die Gruppe meist in zweiwöchigem Takt zum Wandern, Bouldern, Pilzesammeln und Fahrradfahren.
Nach dem Yoga wartet bereits ein Reisebus auf uns. Nächster Stopp: Hochseilgarten. Im Bus sitzen die Coolen bekanntlich hinten. Bei den Black Canarys bedeutet das, die vordersten Sitze bleiben frei. Im Hintergrund läuft Beyonces Song „Brown Skin Girl“, und spätestens bei den Textzeilen: „Brown skin girl / ya skin just like pearls / Your back against the world / I never trade you for anybody else“ singen alle laut mit. Neben mir sitzt Myriam, die eine pharmazeutische Ausbildung macht und mir erzählt, dass sie letztens eine Aknepaste in ihrem Hautton entwickelt hat. Teil der Ausbildung sei das aber nicht.

Myriam und ich verstehen uns so gut, dass wir im Hochseilgarten zu einem Team werden und uns für den grünen Pfad entscheiden, auf dem „FUN“ steht. Vor uns klettert die Teilnehmerin Pearl auf die Plattform. Als auch wir beide oben ankommen, sieht es nicht mehr nach Fun aus, sondern nur noch nach Höhenangst. Wir ziehen es trotzdem durch. Habe ich zu viel Bammel davor, mich in den Abgrund zu stürzen, jubeln mir Pearl und Myriam zu. Wackelt der Holzpfahl zur nächsten Plattform, reiche ich den beiden die Hand. Nach dem Parcours verrät mir Myriam: „Ohne dich hätte ich mich nicht getraut.“ Morgens kannte ich niemanden, am Nachmittag habe ich neue Freundinnen.
Mir fällt auf, dass außer den Clubangehörigen die meisten Menschen im Hochseilgarten weiß sind. „Die Outdoorszene ist auch so exklusiv, weil sie verdammt teuer ist“, sagt Tsellot, die selbst mit Hartz IV groß geworden ist. 27 Euro kostet der reguläre Eintritt zum Hochseilgarten. Normalerweise bezahlt Tsellot einen Teil der Ausgaben. Sie wolle nicht, dass Geld ein Ausschlussfaktor sei. Doch heute findet eine Zusammenarbeit mit einer Turnschuhmarke statt. Diese finanziert den Tag und nutzt im Gegenzug Fotos des Events für ihr Marketing.
27 Euro kostet der Eintritt zum Hochseilgarten. Die Outdoorszene ist auch so exklusiv, weil sie so teuer ist
Die Markenkooperationen sieht Tsellot als gelegentliche finanzielle Unterstützung. Anfragen auf ausschließliche Zusammenarbeit mit einer bestimmten Marke hat sie bislang aber abgelehnt, da sie die Gruppe nicht verkaufen will. „Man bezahlt ja trotzdem einen Preis, und ich will nicht, dass Schwarze Leute dann nur Werbung sind“, sagt Tsellot. Einige Teilnehmer*innen haben heute Sneakers für die Fotos geschenkt bekommen.
Auch Pizzas, Pommes, Rhabarberschorlen und Kuchen im anliegenden Café müssen somit nicht selbst bezahlt werden. Während ein paar dabei sind, sich zu stärken, erzählt eine Teilnehmer*in von ihrem Verehrer. „Er wäre perfekt, wenn er nicht weiß wäre“, sagt sie. Alle nicken verständnisvoll, keiner fragt „Warum?“. Mich beeindruckt das, weil ich aus meinen mehrheitlich weißen Freundeskreisen gewohnt bin, mich für Aussagen dieser Art erklären zu müssen. Bedeutet: Als weiße Person macht man andere Erfahrungen im Leben als eine Schwarze Person. Diese unterschiedlichen Perspektiven zeigen sich in Liebesbeziehungen oder auch im Freundeskreis. Gerade wenn es um Diskriminierung geht, ist es erleichternd, sich nicht auch noch rechtfertigen zu müssen, sondern verstanden zu werden.
Bei Black Canary geht es neben dem Sport um den Community-Aspekt. „Wenn man keinen Schwarzen Freundeskreis hat, kann es ziemlich einsam sein“, teilt Tsellot mit. Denn weiße Menschen nehmen ihrer Erfahrung nach oft nicht wahr, wenn Schwarze Personen Diskriminierung erleben. „Deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und unsere Erfahrungen im Alltag anerkennen“, appelliert Tsellot.

Das hat die Gruppe auch bei ihrem Ausflug zur Ostsee gemerkt. „Im Vorfeld hatte ich bereits ein bisschen Panik und bin deswegen eine Woche davor alleine hochgefahren und habe alles ausgecheckt“, erinnert sich Tsellot. Der Anblick der vielen Menschen mit Swastikatattoos habe sie beunruhigt, sodass sie eine Risikowarnung zur Ausflugsinfo in die WhatsApp-Gruppe des Clubs schrieb. Circa neun Personen hätten sich dennoch getraut. Auf dem Heimweg wurden ihre Sorgen bestätigt. Während andere Fahrgäste im Bus hinten einsteigen durften, rief der Busfahrer den Club nach vorne, um ihre Fahrkarten zu kontrollieren. „Wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich geheult“, hätten einige später gesagt. Zusammen sei es ein bisschen leichter gewesen.
Dennoch steht nicht das gemeinsame Leid im Fokus, sondern der gemeinsame Spaß. Ein Ort, an dem man sich durch das Zusammensein unterstützt und neue Räume öffnet. In der Black-Canary-WhatsApp-Gruppe geht es schon lange nicht mehr nur um Sport. Dort werden Jobs, WG-Zimmer, Friseur*innen und Tipps zu dunklem Make-up geteilt.
Es fällt mir leichter, Neues zu wagen, weil ich mich in der Gruppe sicherer fühle
Zwei Wochen später geht es für mich zum Bouldern. Wenn ich ehrlich bin, muss ich mich dafür morgens ziemlich aus dem Bett quälen. Ich verbinde es mit weißen, drahtigen Männern – ich bin nichts davon. Ich habe Kurven, und die Vorstellung, in einem mehrheitlich weißen Raum auf drei Meter Höhe meinen Po zu präsentieren und dabei wahrscheinlich noch kommentiert zu werden, schreckt mich ab. „Anders fühlen und dann etwas noch nicht zu können ist ein doppelter Austritt aus der Komfortzone“, sagt Pearl, als ich ihr vor der Halle von meinen Bedenken erzähle. Mir scheint das plausibel. Bin ich mit Black Canary unterwegs, sehen alle wie ich aus und haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich gewinne ein bisschen Komfortzone zurück, und es fällt mir leichter, Neues zu wagen, weil ich mich sicherer fühle.
Ich freue mich riesig, als ich Myriam entdecke. In der Halle wärmen wir uns zunächst auf und stellen uns gegenseitig vor. Ich bin erleichtert, dass die Mehrheit auch noch nie bouldern war. Myriam und ich starten mit der Beginner-Wand. Von der orangen – easy – zur gelben – tricky. Nur der blaue Pfad ist mein Endgegner. Vier Mal wage ich einen Anlauf, nach oben schaffe ich es nie. Bei meinem letzten Versuch falle ich wie ein Sack Kartoffeln auf die Matte. Ein bisschen peinlich ist es mir, doch ich lache mit den anderen mit. Schließlich sind wir hier zum Spaß. Und tatsächlich habe ich nicht nur den, sondern richtig Ehrgeiz entwickelt. „Die blaue Wand und ich sind noch nicht fertig miteinander“, rufe ich beim Verlassen der Halle.
Während ich den Text schreibe, packt mich der Ehrgeiz erneut. Allein traue ich mich immer noch nicht zum Bouldern. Also schreibe ich Myriam: „Lust, nächste Woche wieder bouldern zu gehen?“ Abends vibriert mein Handy. Die blaue Wand, Myriam und ich haben eine Verabredung.
Fotos: Meklit Fekadu Tsige